Unsere vernetzte Welt verstehen

Wie die Vergangenheit die Zukunft bestimmt. Die Pfadabhängigkeit des wissenschaftlichen Publizierens
QWERTZ-Welten: Eine Kulturgeschichte der Schreibmaschine
Im Jahr 1867 erfand Christopher Latham Sholes eine primitive Schreibmaschine. Einer ihrer vielen Geburtsfehler war, dass sich die Typenhebel immer wieder gegenseitig blockierten. Auf Drängen seines Investors James Densmore, tüftelte Sholes die nächsten 6 Jahre daran, die Maschine benutzbar zu machen. Nach etlichen Versuchen kam Sholes schließlich auf die bekannte QWERTY oder im Deutschen QUERTZ-Folge, bei der die Typenhebel nicht blockierten, da häufig benutzte Buchstaben, weit voneinander entfernt auf der Tastatur lagen. Als bald darauf Schreibmaschinen industriell hergestellt wurden, setzte sich die QWERTZ-Tastatur als Standard durch.

Eine lesenswerte Geschichte der Entstehung des Keyboards liefert David (1985)
1932 patentierte August Dvorak das DSK-Keyboard (Dvorak Simplified Keyboard) mit einer intuitiveren Tastenfolge, die bis zu 40 Prozent schnelleres Tippen versprach. Zu diesem Zeitpunkt war der QWERTZ-Siegeszug allerdings längst nicht mehr aufzuhalten. Als es längst keine mechanischen Hebel mehr gab, die hätten verklemmen können, hatte sich die QWERTZ-Tastatur bereits als Standard durchgesetzt und ihr Design auf die heutige Computertastatur übertragen. Die Tastatur, auf die ihr gerade schaut, ist ein historischer Unfall.
Pfadabhängigkeit
In der Organisationslehre gibt es ein Konzept, das erklärt wie es dazu kommen konnte, dass wir noch heute suboptimal in die Tasten hauen: Path dependence, auf deutsch Pfadabhängigkeit.

Pfadabhängigkeit bedeutet, dass eine logische Entscheidung in der Vergangenheit zu einem suboptimalen System in der Gegenwart führt. Als Sholes an seiner Schreibmaschine tüftelte, war QWERTZ die beste Lösung, damit sich die Tastenhebel nicht gegenseitig blockierten. In Zeiten der Digitalisierung sind diese Überlegungen aus den Frühen des mechanischen Schreibens vollkommen irrelevant und man wäre mit Dvorak’s Simplified Keyboard besser bedient. Lock-in Phase nennt man das, wenn sich ein suboptimales System etabliert hat. Folgeprodukte nutzen den Standard, Investitionen werden getätigt, Menschen werden darin ausgebildet. Eine QWERTZ-Welt ist geboren. QWERTZ-Systeme überdauern, weil viele darin investiert haben und einen hohen Aufwand durch eine Veränderung hätten. Man überlege, allein wie mühselig es wäre, heute auf eine andere Tastatur umzusteigen. Auch ineffiziente Systeme sind skalierbar.
 QWERTZ-Welten gibt es überall. Sie erklären, weshalb wir suboptimal tippen und weshalb die Straßen in historischen Stadtkernen autounfreundlich sind (siehe mein Urlaubsfoto). Sie zeigen, dass Entscheidungen für einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zwar logisch sind, aber die Fülle an Entscheidungen in der Gegenwart reduziert. QWERTZ-Welten sind behäbige und ineffiziente Systeme. Das akademische Publizieren ist ein gutes Beispiel einer QWERTZ-Welt.
QWERTZ-Welten gibt es überall. Sie erklären, weshalb wir suboptimal tippen und weshalb die Straßen in historischen Stadtkernen autounfreundlich sind (siehe mein Urlaubsfoto). Sie zeigen, dass Entscheidungen für einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zwar logisch sind, aber die Fülle an Entscheidungen in der Gegenwart reduziert. QWERTZ-Welten sind behäbige und ineffiziente Systeme. Das akademische Publizieren ist ein gutes Beispiel einer QWERTZ-Welt.
Vom Siegeszug der Fachzeitschriften
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die vorherrschende Form des wissenschaftlichen Austauschs der Brief oder die Veröffentlichung von Büchern, also entweder sehr exklusiv (Brief) oder sehr zeitaufwendig (Buch). Das änderte sich erst, als um 1660 eine Gruppe Wissenschaftler konspirative Treffen abhielten, um das angestaubte System der Wissensverbreitung zu revolutionieren. Diese Treffen wurden später zu dem was wir heute als die ‘Royal Society of London’ kennen. 1665 gründeten die Konspirativen die ‘Philosophical Transactions of the Royal Society’, die erste wissenschaftliche Zeitschrift. Am Ende des 17. Jahrhunderts gab es bereits 30 periodisch erscheinende wissenschaftliche Zeitschriften. Hand in Hand mit der Aufklärung und der Etablierung der Disziplinen setzte sich der Siegeszug der akademischen Zeitschrift immer weiter fort.
Anfang des 18. Jahrhunderts und lange danach waren die Fachzeitschriften die effizienteste Form der Wissensverbreitung, die Einführung eines Peer-Review die beste Form der Qualitätssicherung und die Bibliotheken die öffentlichste aller Präsentationsformen. Im Kontext ihrer Zeit war die Fachzeitschrift die optimale Form Erkenntnisse zu kuratieren, zu verbreiten und zu diskutieren. Es entstand eine Industrie aus Verlagen, Druck und Distribution. Das noch heute größte wissenschaftliche Verlagshaus, Elsevier, entstand 1880. Das Veröffentlichen in möglichst renommierten Fachzeitschriften ist bis heute die anerkannte Währung für wissenschaftlichen Erfolg.
Seit Jahrhunderten ist der Verlauf von der Fertigstellung eines Artikel bis zu dessen Publikationen in etwa folgender: Eine Wissenschaftlerin reicht einen Artikel bei einer Zeitschrift ein. Wenn der Artikel nicht desk-rejected wird, wird dieser an meist anonyme Fachkollegen weitergegeben (die Reviewer). Diese lesen den Artikel und beurteilen, ob er publikationswürdig ist. Da er das fast nie ohne Weiteres ist, bekommt die Wissenschaftlerin eine Email (Innovation!) mit den Kritiken, den Reviews. Mit etwas Glück, ist darin enthalten eine Bitte diese für eine eventuelle Publikation zu berücksichtigen. Das kann ein paar mal so gehen. Heute dauert es von der Einreichung bis zur Veröffentlichung eines Artikels gut und gerne 2 Jahre. Ist die Zeitschrift erschienen, kaufen Forschungsbibliotheken die Lizenzen und stellen die Artikel Studierenden, Lehrenden und Forschenden zur Verfügung. Ist das noch zeitgemäß?
Dieses System funktioniert, ist aber sicher nicht die effizienteste Form, Inhalte zu verbreiten. Viele der historischen Stärken des printbasierten Veröffentlichens in Fachzeitschriften verkehren sich mit der Digitalisierung ins Gegenteil.
Pfadabhängiges Reviewverfahren
Das zuvor beschriebene Reviewverfahren ist ein gutes Beispiel. Das System der Qualitätskontrolle durch wenige, hochqualifizierte Experten hat sich über Jahrzehnte bewährt. Je höher gerankt die Zeitschrift, desto formidabler liest sich die Liste ihrer Editoren. Dennoch ist es streitbar, dass in der Regel zwei Fachkollegen über die Relevanz eines Inhalts für eine ganze Forschungsgemeinschaft bestimmen. Hinzu kommt, dass sich Artikel ohne Weiteres über Jahre im Reviewlimbo befinden können. Es ist absurd, dass es heutzutage so lange dauert, bis eine Forschungserkenntnis von einem Fachpublikum rezipiert werden kann.
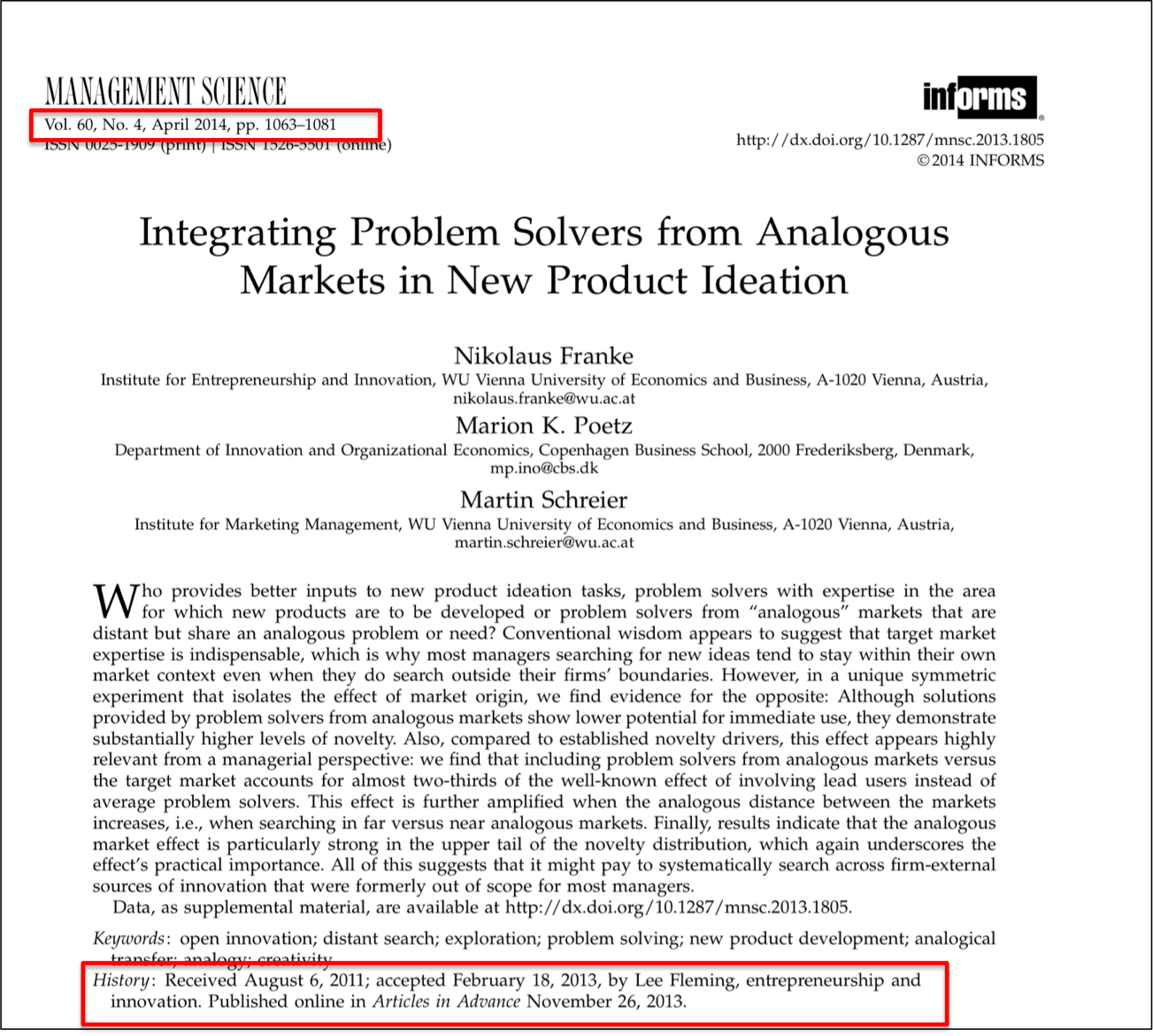
Dabei zeigen Plattformen wie PLOS ONE, dass es auch anders geht. Bei PLOS ONE werden Artikel nach einer grundlegenden Überprüfung online gestellt. Die Forschungsgemeinschaft kann sich somit sicher sein, dass die Artikel zumindest den Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis entsprechen. Die Fachgemeinschaft kann unter den Online-Einträgen diskutieren und die Artikel bewerten. Man darf sich zurecht fragen, ob langfristig eine Community-Metrik die Qualität und Relevanz eines Inhalts nicht besser abbildet, als ein Index, der nur die Anzahl der Zitationen berücksichtigt. Bei PLOS ONE gibt es zudem keine periodische Ordnung, ein kurzes grundlegendes Review, vergleichsweise geringe Publikationsgebühren und die Möglichkeit, die Fachgemeinschaft selbst über die Relevanz eines Artikels entscheiden zu lassen. Alle Artikel sind selbstverständlich Open Access. PLOS ONE hat den Staub des Printzeitalters abgeschüttelt. Warum machen das andere nicht auch?
Pfadabhängiges Format
Beim Vergleich des wissenschaftlichen Publikationswesens mit der Zeitungsindustrie analysiert Davis (2014) in einem bei Administrative Science erschienen Leitartikel sehr treffend:
“New technologies of communication should enable new ways of sharing and advancing knowledge. Newspapers have been radically transformed by the Internet revolution, adapting their format to continuous updating, color, video, and opportunities for feedback and debate by readers. Yet academic journals still bear the imprints of their origins, and most look little different today than they did 50 years ago.”
Es ist allerdings etwas ironisch, dass ein Artikel, der interessante Diskussionen herbeiführen könnte, auf einer Plattform steht, die keine Kommentarfunktion hat. Es zeigt auch, dass sich das wissenschaftliche Veröffentlichen vielleicht in ein zu enges Korsett schnürt. Die Präsentation von Inhalten folgt oft einer analogen Logik. Warum können Artikel nicht auf der Plattform, auf der sie erscheinen, diskutiert werden? Warum kann man Daten, die in einer Publikation verwendet werden, nicht einsehen (oder selbst nutzen)? Warum gibt es online Seitenzahlen?
Pfadbhängige Zugänglichkeit
Die Etablierung eines Zeitschriften-dominierten Publikationssystems treibt gerade im Zusammenhang mit der Debatte um den Zugang zu öffentlich finanzierter Forschung seltsame Blüten. Möchte ein Autor einen Artikel Open Access, also für alle kostenlos, zur Verfügung stellen, kann dies bei bekannten Fachzeitschriften gut und gerne 2500 Euro kosten. Andernfalls können den Artikel nur Lizenznutzer lesen. Die Bibliothek der University of California hat eine Auflistung veröffentlicht, die einen guten Eindruck über die Open Access Gebühren vermittelt.
Forschungsbibliotheken geben jährlich Millionen für Zeitschriftenlizenzen aus. Selbst die Harvard University sagt, dass sie diese Kosten kaum noch stemmen kann. Sie ruft Ihre Forscher auf, Artikel nicht hinter die Paywalls von Fachzeitschriften zu verstecken. Dennoch ist für die meisten Forschenden die Publikation in einem renommierten (= meist teuren) Journal eine Auszeichnung. Sie kann die Karriere befördern und kommt immer gut an bei Forschungsförderungsanträgen. Sie ist eine anerkannte Währung für wissenschaftlichen Erfolg. Es ist geradezu unlogisch, einen anderen als den steinigen Weg zur Publikation zu gehen.
Warum ist die Zugänglichkeit zu öffentlich finanzierter Forschung noch immer so stark gekoppelt an Lizenzen? Warum kauft man seine Artikel frei? Gibt es keine besseren Technologien, Exzellenz kenntlich zu machen und zu belohnen?
Wie in der Geschichte des QWERTZ-Keyboards hat sich beim wissenschaftlichen Veröffentlichen ein System etabliert, dass suboptimal ist. Die bekannte Publikationspraxis mit Einreichung, Review und Veröffentlichung ist angesichts der neuen sozio-technischen Möglichkeiten längst überholt. Sie dauert zu lange, sie ist zu teuer und führt zu einer künstlichen Verknappung von Inhalten. Sie entspricht nicht dem Zeitgeist.
Einen Blick über den Tellerrand: Die Printkrise
Wirft man einen Blick auf andere Industrien, deutet sich ein immer gleiches Muster an. Wandel wird durch Innovationen hervorgerufen, neue Kontextfaktoren führen zu neuen Organisationslogiken. Organisatorischer Wandel ist für etablierte Organisationen schwierig aber notwendig.
Nehmen wir wieder den Zeitungsmarkt zur Veranschaulichung. Nur die Verlagshäuser, die sich erfolgreich auf neue Kundenbedürfnisse, Rezeptionsverhalten und Finanzierungsmodelle in Zeiten des medialen Wandels (Stichwort Narrowcasting) einstellen können, sind erfolgreich. Daneben entstehen neuartige, klickoptimierte und oft user-generierte Informationsportale, die, ob gut sei mal dahin gestellt, die gängigen Wertschöpfungslogiken und Geschäftsmodelle erfolgreich ad acta legen (z.B. Huffington Post, mashable etc.).
Neue Kontextbedingungen führen zu neuen Organisationsformen, die die alten in Frage stellen. Viele traditionelle Verlagshäuser überleben die Printkrise nicht. Die Anpassung alter Organisationsformen an neue Kontextfaktoren ist schwierig. Für etablierte Unternehmen ist die Anpassung zudem kostspielig. Karim und Mitchell (2000) zeigen beispielsweise, dass es eine gängige Strategie für Firmen ist, organisatorischen Wandel durch Aufkauf ‘frischer’ Start-Ups herbeizuführen. Axel Springer verfolgt diese Strategie konsequent. Man muss kein großer Analyst sein, um zu erkennen dass sich eine solche Verjüngungskur nur wirtschaftlich erfolgreiche Verlagshäuser leisten können.
Wandel des wissenschaftlichen Publizierens?
Beim wissenschaftlichen Publizieren zeichnet sich auch ein Wandel der Organisationsformen ab. Davon zeugen innovative Publikationsplattformen wie PLOS ONE und (in Teilen) SSRN, die neue Verbreitungs- und Bewertungslogiken anwenden. Davon zeugen gleichsam Rechtsstreitigkeiten wie etwa zwischen Academia.edu und Elsevier, Investitionen wie die von Microsoft in Researchgate oder Akquisitionen wie die von Mendeley durch Elsevier. Angetrieben wird die Neuorganisation der Inhalte auch von der schwelende Debatte um den offenen Zugang zu Veröffentlichungen. Im Kontext von Open Access und Pfadabhängigkeit des wissenschaftlichen Publizierens ist daher auch die Debatte um den Impact von Open Access Zeitschriften (hier und hier) oder alternative Bewertungsmechanismen für wissenschaftliche Leistung (Altmetrics) hochinteressant. Die Maßregeln für wissenschaftliche Leistung, und damit gewissermaßen das ganze Wissenschaftssystem, werden öffentlich, auch von Seiten renommierter Wissenschaftler, zumindest hinterfragt.
Sicherlich unterscheidet sich der Zeitungsmarkt vom wissenschaftlichen Publizieren in einigen Aspekten. Die Verflechtung von öffentlicher und privater Finanzierung ist in der Wissenschaft weitaus größer als beim Zeitungsmarkt (Stichwort 4. Gewalt). Beim wissenschaftlichen Publizieren sind monetäre (privatwirtschaftliche Verlage und Plattformen) und symbolische Austauschlogiken (Autorenschaft, Review, Partizipation auf Plattformen) eng miteinaner verzahnt. Die größten Player wirtschaften seit Jahren äußerst profitabel. Zudem muss wissenschaftlicher Output und dessen Bewertung formalisierter, also vergleichbarer sein. Eine Krise, wie in der Zeitungsindustrie, ist nicht zu erwarten. Eine Revolution der Inhalte wird beim wissenschaftlichen Publizieren weitaus gemächlicher von Statten gehen als in der Zeitungsbranche. Aber sie wird kommen.
Mögliche Entwicklungen
Die Pfadabhängigkeit des wissenschaftlichen Veröffentlichens spiegelt sich in der Form der Qualitätssicherung (Review), der Präsentation der Inhalte (PDF-Regime) und der Zugänglichkeit öffentlich finanzierter Forschung.
In seiner Analyse der gegenwärtigen Bedeutung von Fachzeitschriften, erkennt Davis im Reviewverfahren die Haupttechnologie wissenschaftlicher Journale. Demnach ist das Kuratieren von Inhalten und die Identifikation exzellenter Forschung, die einzigartige Leistung des print-orientieren Veröffentlichens. Es drängt sich die Frage auf, ob alternative, technik-unterstützte Reviewmechanismen zu einer effizienteren und besseren Bewertung wissenschaftlicher Leistung führen. Kann beispielsweise ein community-basiertes Reviewverfahren, wie etwa bei PLOS ONE, die herkömmliche Peer-Review ersetzen? Und wie erkennt und belohnt man dann exzellente Artikel?
Neben dem Review, entstammen auch die Präsentation (function follows form) und die Zugänglichkeit von Artikeln einer Logik aus dem Buchzeitalter. Artikel erscheinen häufig noch periodisch und unnötig zeitversetzt. Inhalte können so gut wie nie ergänzt oder kommentiert werden. Und zu viel steuerfinanzierte Forschung versteckt sich hinter einer Bezahlschranke.
Sofern flache und dezentrale Organisationsstrukturen für wissenschaftliche Information zu einer besseren Wertschöpfung führen, stellt sich die Frage, wie sich etablierte Verlage darauf einstellen und inwiefern sich neue Organisationsformen (wie PLOS ONE) durchsetzen.

Falls wir in 50 Jahren noch suboptimal veröffentlichen, haben wir mit Pfadabhängigkeit zumindest eine beschwichtigende Erklärung.
Einige Zeichen stimmen optimistisch: Die Royal Society, die uns einst das ganze eingebrockt hat, entwarf 2012 mit “Science as an Open Enterprise” eine bedachte und innovative Vision für eine Wissenschaft im Internetzeitalter. Vermutlich haben sie diese auf einem QWERTZ-Keyboard getippt. Manche Dinge ändern sich eben nie.
Vielen Dank an Hendrik Send, Cornelius Puschmann, Sascha Friesike, Stefan Stumpp und Fiona Weber für ihre wertvollen Kommentare zu diesem Blogbeitrag.
Bilder
- QWERTY: Eelke
- Sholes: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sholes_at_his_typewriter.jpg
- Keyboard: http://en.wikipedia.org/wiki/Dvorak_Simplified_Keyboard#mediaviewer/File:KB_United_States_Dvorak.svg
- Sarajevo streets: Copyright Jorge Rico Villar
- Cover management science: http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2013.1805
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autorinnen und Autoren und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Offene Hochschulbildung
Zwischen Vision und Realität: Diskurse über nachhaltige KI in Deutschland
Der Artikel untersucht die Rolle von KI im Klimawandel. In Deutschland wächst die Besorgnis über ihre ökologischen Auswirkungen. Kann KI wirklich helfen?
Ein Schritt vor, zwei zurück: Warum Künstliche Intelligenz derzeit vor allem die Vergangenheit vorhersagt
KI gilt als Zukunftstechnologie, stützt sich selbst aber meist auf historische Daten. Reproduziert sie dadurch soziale Ungleichheiten und Verzerrungen?
Zwischen Zeitersparnis und Zusatzaufwand: Generative KI in der Arbeitswelt
Generative KI am Arbeitsplatz steigert die Produktivität, doch die Erfahrungen sind gemischt. Dieser Beitrag beleuchtet die paradoxen Effekte von Chatbots.




