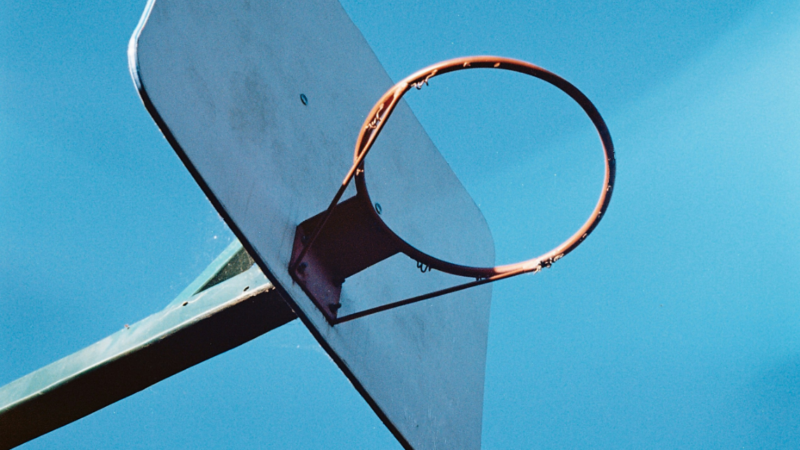Unsere vernetzte Welt verstehen

Wer verbreitet wo, wozu und wie viel Desinformation?
Desinformation bedroht die Demokratie. So lautet ein weit verbreitetes Narrativ. Doch wie viel Falschinformation verbreiten Politiker*innen tatsächlich? Auf welchen Plattformen und zu welchen Zwecken? Zwei neue Studien liefern systematische Antworten: Sie zeigen, dass Desinformation kein Randphänomen sozialer Medien ist, sondern auch in Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorkommt. Besonders aktiv sind AfD, Union und BSW, allerdings mit unterschiedlichen Zielen. Während die AfD vor allem Institutionen angreift, nutzt die Union Desinformation, um politische Gegner zu attackieren. Der Blogbeitrag fasst drei zentrale Ergebnisse zusammen.
Die Attacken auf demokratische Grundpfeiler, wie freie Wahlen oder die Unabhängigkeit von Gerichten, werden viel diskutiert. Oft gilt Desinformation dabei als eine Form dieser Angriffe. Besonders die sozialen Medien stehen im Verdacht, die Verbreitung von Unwahrheiten zu begünstigen. Zu Recht? Zusammen mit Kollegen habe ich zwei Studien zur Verbreitung von Desinformation durch deutsche Politiker*innen verfasst. In der einen Studie ging es um Desinformation in den sozialen Medien (Nenno, Puschmann, Fuławka und Lorenz-Spreen 2025) und in der anderen um Desinformation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (Nenno 2025). In diesem Blogpost möchte ich drei zentrale Ergebnisse daraus teilen, die einen Eindruck liefern, wer wo, wozu und wie viel Desinformation verbreitet.
Zuvor noch eine begriffliche Unterscheidung zur besseren Einordnung der Ergebnisse. Die beiden Studien untersuchen die Verbreitung von Desinformation – das ist nicht dasselbe wie Aussetzung und Wirkung. Wir konsumieren nicht alle dieselben Informationen; mehr Verbreitung bedeutet also nicht zwangsläufig, dass alle Menschen falschen Informationen stärker oder gleichmäßig ausgesetzt sind. Und selbst wer Desinformation ausgesetzt ist, ändert sein Verhalten nicht notwendigerweise. Welche Interpretationen lassen unsere Ergebnisse also über die Verbreitung von Desinformation zu?
Desinformation – weit verbreitet oder falscher Alarm?
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl an Studien erschienen, welche die Verbreitung von Online- Desinformation messen (Acerbi et al. 2022). Diese kommen meistens zu dem Schluss, dass Desinformation nur sehr gering verbreitet ist. Einige Forscher*innen argumentieren deshalb, dass die öffentliche Aufregung über Desinformation übertrieben sei (Budak et al. 2024, Nenno 2024). Dies ist aber nicht die einzige Interpretation. Wenn Desinformation online nur gering verbreitet ist, aber so viele Menschen von ihr wissen, dann liegt es vielleicht daran, dass ihre Reichweite durch die Berichterstattung etablierter Medien verstärkt wird (Tsfati et al. 2020). Zudem kam auch noch ein methodischer Einwand: streng genommen untersuchen die Studien nur einen Bruchteil der Arten von Desinformation. Sie identifizieren Links zu Nachrichtenseiten, die häufig Desinformation verbreiten (Ecker et al. 2025). Steckt die Desinformation aber beispielsweise im Fließtext eines Social Media Posts, dann wird sie nicht erkannt.
Das Ziel der beiden Studien war es, diese Bedenken aufzugreifen und zu verknüpfen. Dafür haben wir eine neuartige Messmethode verwendet. Mit Hilfe von Large Language Models analysierten wir Texte, um darin strittige oder überprüfbare Aussagen zu erkennen. Dafür glichen wir diese neuen Texte automatisch mit einer Datenbank von Faktenchecks ab, um Desinformation zu identifizieren. Das klingt wie ein technisches Detail. Aber zum einen erlaubt die Methode uns, die Fließtexte von Posts in den Blick zu nehmen und zum anderen die Verbreitung von Desinformation in Transkripten von TikTok-Videos oder auch Fernsehformaten zu messen. Mit anderen Worten, gegenüber vorherigen Studien konnten wir die Analyse auf neue Medienformate und -inhalte ausweiten.
Im Fokus der Studien standen deutsche Politiker*innen und ihre Parteiaccounts – also nicht Desinformation durch zivilgesellschaftliche Akteure oder ausländische Kampagnen. Politiker*innen und Parteien sind zentrale Akteure in der öffentlichen Meinungsbildung und entsprechend schwerwiegend kann es sein, wenn sie Desinformation verbreiten.
1) Desinformation ist nicht gleichmäßig verteilt
1.14% der Posts in den sozialen Medien enthielten Desinformation. Dabei war die Rate auf Facebook am höchsten (1.52%), gefolgt von TikTok (1.43%), Instagram (0.97%) und X/Twitter (0.73%). Zunächst einmal ist dieser Befund nicht überraschend. In den sozialen Medien werden die unterschiedlichsten Inhalte gepostet – von Katzenvideos über Osterwünsche bis hin zu Propaganda. Wir sollten also davon ausgehen, dass jeglicher spezifische Inhalt, in diesem Fall Desinformation, nur einen sehr kleinen Anteil an allen Posts ausmacht. Wichtiger als eine Zahl für alle Posts ist daher die Frage, in welchen Bereichen sich der Großteil der Desinformation konzentriert und ob sich diese Segmente identifizieren lassen. Gibt es Themen oder Akteure, die besonders anfällig für die Verbreitung von Desinformation sind?
Unter den Parteiaccounts teilte die AfD am meisten Desinformation. Ihr folgten CDU, CSU und BSW, während SPD, Grüne, Linke und FDP kaum Desinformation verbreiteten. Thematisch konzentrierte sich Desinformation vor allem auf wirtschaftliche Inhalte (z. B. die Mehrwertsteuer in der Gastronomie), gefolgt von Recht und Kriminalität sowie Landwirtschaft (z. B. Subventionen im Agrarsektor).
Führt man Akteure und Themen zusammen, steigerte sich die Konzentration: So enthielten 6% aller Posts über Landwirtschaft Desinformation, aber für Posts der CDU über Landwirtschaft waren es sogar 12%. Bei Posts der CSU über den Gesundheitsbereich (z.B. Entkriminalisierung von Cannabis) lag der Anteil bei knapp 9% und für die AfD zur Energieversorgung (z.B. energetische Sanierung) bei 8%. Die insgesamt niedrige Rate von Desinformation verschleiert also die hohe Verbreitung in manchen Segmenten.
2) Desinformation ist kein exklusives Social Media Problem
Bisher ging es um die Verbreitung von Desinformation auf Plattformen wie Facebook. Es bleibt jedoch die Frage: Handelt es sich bei Desinformation ausschließlich um ein Social-Media-Phänomen? Meine Hypothese war, dass es in Formaten wie Talkshows nicht schnell genug möglich ist, Falschaussagen von Gästen zu korrigieren und daher auch dort Desinformation vorkommt.
Tatsächlich enthielten im Schnitt fast 12 Prozent der Folgen von Sendungen wie Markus Lanz, Hart aber Fair oder Maischberger mindestens eine falsche Behauptung. Auch das ist nicht unbedingt überraschend, denn einige dieser Shows veröffentlichen eigene Faktenchecks, in denen Behauptungen der letzten Folge überprüft werden. Sie gehen also schon davon aus, dass ihre Gäste nicht immer korrekt liegen. Die Rate lag aber noch höher, als die internen Faktenchecks vermuten ließen.
Im Vergleich stammte die meiste Desinformation von Politiker*innen der AfD, gefolgt von der Union und dem BSW. Während Desinformation häufig mit Verschwörungstheorien oder ähnlichen Narrativen in Verbindung gebracht wird, handelte es sich in den Talkshows um andere Arten von falschen Erzählungen. Es ging um Themen, die zum jeweiligen Zeitpunkt im Mittelpunkt öffentlicher Debatten standen. Zum Beispiel die Bezahlkarte für Asylbewerber*innen und die unbelegte Behauptung, dass diese schon zu Ausreisen geführt hätte. Das deckte sich mit den Ergebnissen auf Social Media: Desinformation, die von Politiker*innen geteilt wurde, handelte häufig von aktuell kontrovers diskutierten Themen.
3) Die Art der Desinformation unterscheidet die AfD von den anderen Parteien
Die zwei von uns verfassten Studien zeigen, dass die AfD zwar den größten Anteil an Desinformation verbreitete, die Unionsparteien jedoch ebenfalls erheblich dazu beitrugen. Auffällig war zudem, dass dies nicht nur auf einzelne CDU/CSU-Politiker*innen zurückzuführen war, sondern sich über weite Teile der Parteien und sogar deren offizielle Accounts erstreckte. Mit anderen Worten: Betrachtet man allein die Menge der verbreiteten Desinformation, fiel der Unterschied zwischen AfD und Union geringer aus, als man vermuten würde.
Es geht aber nicht nur um die Menge an Desinformation. Die Social Media Studie zeigt, dass die AfD inhaltlich isolierter war als die Union. Die individuellen Falschbehauptungen, die von der AfD geteilt wurden, wurden seltener von anderen Parteien aufgegriffen als diejenigen der Union. In der Studie zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen war es möglich, die Inhalte noch genauer zu analysieren. Es stellte sich heraus, dass die AfD Desinformation häufig nutzte, um demokratische Institutionen anzugreifen, während die Union sie nutzte, um politische Konkurrenten zu attackieren. So verbreitete die AfD beispielsweise falsche Informationen, um Zweifel an der Integrität des Verfassungsschutzes zu schüren, während die Union unbelegte Behauptungen zur Migration machte, um die Asylpolitik der vorigen Ampelregierung zu kritisieren.
Wer verbreitet wo, wozu und wie viel Desinformation?
Desinformation durch Politiker*innen wird in Deutschland vorrangig von der AfD, aber auch dem BSW und den Unionsparteien verbreitet. Dies geschieht online, aber auch in Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Für die meisten Themenbereiche ist die Rate an Desinformation sehr gering und das gilt auch für Posts oder Talkshowauftritte von Politiker*innen einiger Parteien. Aber gerade für kontrovers diskutierte Themen und Beiträge von AfD oder Union, kann die Wahrscheinlichkeit für Desinformation relativ hoch sein. Während die Union Desinformation vor allem nutzt, um politische Gegner anzugreifen, richtet sich die AfD mit falschen Behauptungen häufig gegen demokratische Institutionen.
Wie eingangs erläutert, reicht die bloße Verbreitung von Desinformation nicht aus, um ihre Wirkung zu verstärken. Eine Zunahme von Desinformation vor Wahlen bedeutet nicht automatisch dass sich Wähler*innen an der Urne anders entscheiden. Dennoch steigt mit ihrer Verbreitung das Risiko für solche Effekte. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, auf Desinformation zu stoßen, für Beiträge mancher Akteure zu bestimmten Themen nicht unerheblich ist.
Zudem sollten wir einen zweiten Aspekt nicht aus dem Blick verlieren. Berechtigterweise sorgen wir uns über die negativen Folgen des Konsums von Desinformation, aber unsere Studien zeigen auch etwas über die Produktionsseite, also die Politiker*innen, die Desinformation verbreiten. Es geht hier nicht um ein paar Politiker*innen einer einzelnen Partei, sondern um große Teile mehrerer Parteien. Auch wenn die Wirkung unklar bleibt, zeigen unsere Ergebnisse, dass Desinformation fest in der Kommunikation einiger politischer Akteure und Parteien verankert ist.
Referenzen
Acerbi, A., Altay, S., & Mercier, H. (2022). Research note: Fighting misinformation or fighting for information? Harvard Kennedy School Misinformation Review. https://doi.org/10.37016/mr-2020-87
Budak, C., Nyhan, B., Rothschild, D. M., Thorson, E., & Watts, D. J. (2024). Misunderstanding the harms of online misinformation. Nature, 630(8015), 45–53. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07417-w
Ecker, U. K. H., Tay, L. Q., Roozenbeek, J., van der Linden, S., Cook, J., Oreskes, N., & Lewandowsky, S. (2025). Why misinformation must not be ignored. American Psychologist, 80(6), 867–878. https://doi.org/10.1037/amp0001448
Nenno, S. (2024). Desinformation: Überschätzen wir uns? – Digital Society Blog. Digital Society Blog. https://www.hiig.de/desinformation-ueberschaetzen-wir-uns/
Nenno, S. (2025). Separate worlds of misinformation. An explorative study of checked claims in German public broadcast news and talk shows. Information, Communication & Society, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2561030
Nenno, S., Puschmann, C., Fuławka, K., & Lorenz-Spreen, P. (2025). Content-based detection of misinformation expands its scope across politicians and platforms (No. p6yh9_v1). SocArXiv. https://doi.org/10.31235/osf.io/p6yh9_v1
Tsfati, Y., Boomgaarden, H. G., Strömbäck, J., Vliegenthart, R., Damstra, A., & Lindgren, E. (2020). Causes and consequences of mainstream media dissemination of fake news: Literature review and synthesis. Annals of the International Communication Association, 44(2), 157–173. https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1759443
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autor*innen und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Themen im Fokus
Der Human in the Loop bei der automatisierten Kreditvergabe – Menschliche Expertise für größere Fairness
Wie fair sind automatisierte Kreditentscheidungen? Wann ist menschliche Expertise unverzichtbar?
Gründen mit Wirkung: Für digitale Unternehmer*innen, die Gesellschaft positiv gestalten wollen
Impact Entrepreneurship braucht mehr als Technologie. Wie entwickeln wir digitale Lösungen mit Wirkung?
Bias erkennen, Verantwortung übernehmen: Kritische Perspektiven auf KI und Datenqualität in der Hochschulbildung
KI verändert Hochschule. Der Artikel erklärt, wie Bias entsteht und warum es eine kritische Haltung braucht.