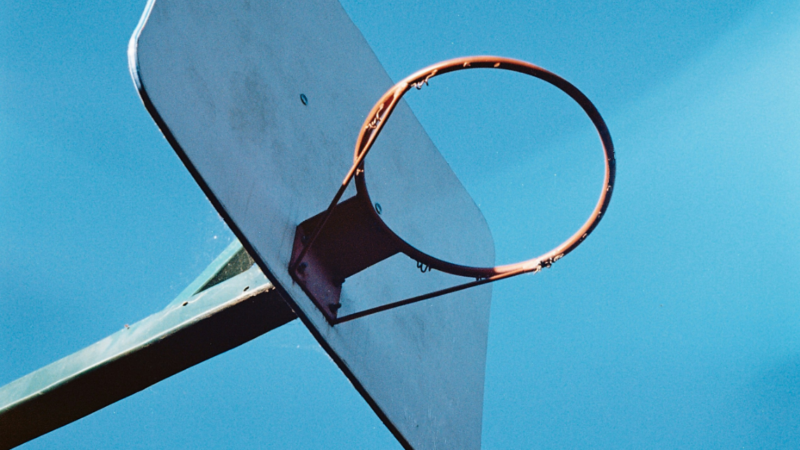Unsere vernetzte Welt verstehen

Jenseits von Big Tech: Nationale Strategien für Plattformalternativen
Internetunternehmen wie Google, Amazon und YouTube sind heute zu zentralen digitalen Infrastrukturen für wirtschaftliche Aktivitäten, soziale Interaktionen und die Meinungsbildung weltweit geworden. Ihre Marktdominanz – eng verknüpft mit dem plattformbasierten Online-Geschäftsmodell – wirft Fragen nach verzerrtem Wettbewerb, wachsenden Abhängigkeiten und starken Lock-in-Effekten auf. Diese großen westlichen Technologiekonzerne, oft als Big Tech bezeichnet, kontrollieren riesige Datenmengen und prägen, wie Unternehmen, Regierungen und Individuen online miteinander interagieren. Bisher wurden vor allem Regulierungsmaßnahmen wie Wettbewerbs- und Kartellrecht eingesetzt, um diesen Entwicklungen zu begegnen. Einige Länder verfolgen jedoch inzwischen eine proaktivere Strategie: China, Russland und Indien haben eigene Plattformalternativen aufgebaut, um die Kontrolle über zentrale digitale Dienste und Daten zu gewinnen. Was treibt diese nationalen Strategien an? Und welche Lehren kann Europa daraus ziehen, wenn es versucht, seine eigene digitale Umwelt zu gestalten, die Abhängigkeit von US-Plattformen zu verringern und ein unabhängigeres digitales Ökosystem zu entwickeln? Ein besseres Verständnis dieser unterschiedlichen Ansätze zeigt nicht nur die geopolitische Bedeutung der Plattformökonomie, sondern auch die praktischen Auswirkungen für Unternehmen, Regierungen und Nutzer*innen weltweit.
Staatlich gelenkte Modelle: Digitale Souveränität in China
Mitte der 2000er-Jahre, als westliche Plattformen weltweit an Bedeutung gewannen, begannen viele Länder, die strategische Bedeutung digitaler Infrastrukturen für die Verbreitung von Inhalten zu erkennen. China und Russland gehörten zu den ersten Staaten, die angesichts wachsender Befürchtungen über den Einfluss ausländischer Unternehmen auf die öffentliche Meinung eine stärkere nationale Kontrolle über zentrale Internetdienste priorisierten. Dies führte zur Einführung von Maßnahmen, die darauf abzielten, einen Verlust politischer Kontrolle zu verhindern.
Seit dem Anschluss an das globale Internet in den 1990er-Jahren hat sich Chinas Internetwirtschaft unter zwei zentralen Zielsetzungen entwickelt: der Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und der Kontrolle der nationalen Internetinfrastruktur. Anfangs war der chinesische Markt relativ offen für US-amerikanische Unternehmen und Investitionen, sodass ausländische Firmen eintreten und Kapital einbringen konnten. Dennoch blieben westliche Unternehmen weitgehend erfolglos.
Mit der Einführung der „Großen Firewall“ Anfang der 2000er-Jahre schuf die chinesische Regierung ein System, das bestimmte ausländische Websites filtert und blockiert. Kurz darauf begann sie, systematisch den Zugang zu politisch sensiblen Inhalten zu unterbinden. Bis 2009 waren globale Plattformen wie Facebook, Twitter, Google und YouTube vollständig blockiert. Westliche Unternehmen wurden damit faktisch aus dem chinesischen Online-Ökosystem ausgeschlossen.
Diese Beschränkungen schufen Raum für nationale „Champions“: Baidu etablierte sich als führende Suchmaschine, Tencent entwickelte populäre soziale Netzwerke und Messaging-Dienste, und Alibaba baute bedeutende E-Commerce- und Cloud-Plattformen auf. Diese Unternehmen konnten sich als nationale Alternativen zu globalen Diensten behaupten und zugleich neue Angebote für den größten digitalen Markt der Welt entwickeln.
Aufbau nationaler Autonomie in Russland
Im Gegensatz zu China war Russland nicht in der Lage, seinen heimischen Markt vollständig abzuschotten. Der Grund dafür lag in der anderen technologischen Architektur seiner Internetinfrastruktur. So verfügte Russland beispielsweise über deutlich mehr grenzüberschreitende Internetverbindungen als China. Bis zum Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 existierten russische Plattformen neben westlichen Anbietern. In Bereichen wie Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und E-Commerce entstand ein lokales Ökosystem nationaler Alternativen, die sich als Marktführer etablierten, da sie russischsprachige Nutzer*innen ansprachen und deren Bedürfnisse besser kannten.
Im Jahr 2008 entwickelten sich sowohl russische als auch ausländische Plattformen zu Orten, an denen Nutzer*innen ihre Unzufriedenheit mit der Regierung äußerten. Die Regierung begann daraufhin, das Internet als Instrument ausländischer Einflussnahme zu betrachten, und damit als Bedrohung für die politische Stabilität und die Sicherheit des Regimes. Während der digitale Markt formal sowohl für inländische als auch für ausländische Unternehmen offen blieb, zog die russische Regierung die politische Kontrolle über Online-Inhalte zunehmend an sich und sicherte sich zugleich Einfluss auf zentrale nationale Internetunternehmen. Sie schuf außerdem ein Umfeld, in dem als strategisch wichtig eingestufte Firmen, darunter Yandex (Suchmaschine) und Mail.ru/VKontakte (soziales Netzwerk), wachsen konnten. So verpflichtete die Regierung etwa den vorinstallierten Einsatz inländischer Dienste auf in Russland verkauften Smartphones.
Mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den darauf folgenden internationalen Spannungen zwischen Russland und dem Westen unterstützte die Regierung aktiv die Entwicklung nationaler Technologien in verschiedenen Märkten. Ziel dieser Bemühungen war es, sicherzustellen, dass kritische digitale Infrastrukturen unter nationaler Kontrolle bleiben – für den Fall, dass westliche Dienste nicht mehr verfügbar sein sollten.
Die russischen Bestrebungen, digitale Souveränität zu erlangen, wurden 2022 auf die Probe gestellt: Nach dem militärischen Angriff auf die Ukraine und der Verhängung umfassender Finanzsanktionen zogen sich zahlreiche westliche Unternehmen aus dem russischen Markt zurück. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Russland jedoch bereits über nationale Plattformen in zentralen digitalen Bereichen, die in anderen Ländern meist von US-amerikanischen Firmen abgedeckt werden.
Digitale öffentliche Infrastruktur: Indiens Open-Data-Strategie
Während China und Russland ihre digitalen Ökosysteme weitgehend durch Marktabschottung aufgebaut haben, verfolgt Indien einen anderen Weg. Anstatt Märkte zu schließen, investiert das Land in eine öffentliche digitale Infrastruktur, die sowohl Bürger*innen als auch Unternehmer*innen zugutekommt. Dieses Vorgehen spiegelt eine Sorge wider, die viele Länder teilen: US-amerikanische Plattformgiganten wie Amazon, Google und Meta agieren als Torwächter. Sie kontrollieren den Zugang zu zentralen digitalen Märkten, wodurch viele Unternehmen und Nutzer*innen ihre Kundschaft nur über diese Plattformen erreichen können. Die Plattformen bestimmen die Spielregeln der Teilnahme, etwa Gebühren, Sichtbarkeit und Transaktionsbedingungen. Zudem sammeln sie enorme Mengen an Daten aus der Nutzung und den Transaktionen, was ihnen einen strategischen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschafft.
Im Jahr 2015 startete die indische Regierung die Initiative Digital India, um eine nationale digitale Infrastruktur aufzubauen, die eine Alternative zu bestehenden Plattformökosystemen bieten soll. Ein zentrales Projekt dabei ist India Stack, ein offenes Datennetzwerk, das den Austausch von Informationen zwischen öffentlichen Diensten, Behörden, App-Entwicklern, Unternehmen und Start-ups erleichtert. Möglich wird dies durch ein System offener Application Programming Interfaces (APIs) – standardisierte Schnittstellen, die es verschiedenen digitalen Diensten erlauben, miteinander zu kommunizieren und Daten sicher auszutauschen.
Um die Abhängigkeit von dominanten Plattformen zu verringern, führte die indische Regierung außerdem das Open Network for Digital Commerce (ONDC) ein. Diese Initiative soll den Einfluss von Flipkart, Indiens größtem E-Commerce-Unternehmen, und von Amazon einschränken. Gleichzeitig fördert sie die Entwicklung nationaler Alternativen zu zentralen US-Technologien wie App-Stores und Betriebssystemen. Durch die Verringerung der Rolle westlicher Vermittler möchte die Regierung sicherstellen, dass ein größerer Anteil der Gewinne der digitalen Wirtschaft bei lokalen Unternehmer*innen verbleibt, anstatt von mächtigen Plattformunternehmen abgeschöpft zu werden. Ob eine staatlich von oben gesteuerte Initiative in einem offenen Markt tatsächlich erfolgreich sein kann, bleibt allerdings abzuwarten.
Europas Weg in die Zukunft
Aber wie steht es um Europa? Im Gegensatz zu Ländern wie China, Russland und Indien, die eigene nationale Plattformalternativen zu den dominanten US-Plattformen entwickelt haben, ist Europas Weg deutlich stärker mit der globalen Plattformökonomie verflochten. Zwar gab es Erfolge bei der Förderung europäischer Plattformen in den Bereichen E-Commerce, Fahrdienstvermittlung und Lieferdienste (Lehdonvirta, Park, Krell & Friederici, 2020), doch keines dieser Unternehmen konnte die marktbeherrschenden US-Plattformen ersetzen.
Europa positionierte sich als Teil eines transatlantischen Internet-Konsumraums, dessen kulturelle und politische Nähe zu den USA die Expansion der großen Plattformen auf dem europäischen Markt erleichterte. So bevorzugten europäische Regierungen etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen regelmäßig internationale Technologieunternehmen wie Amazon oder Microsoft als Partner für Softwarelösungen. Auch die geltenden Regulierungen haben es US-Unternehmen erleichtert, europäische Firmen zu übernehmen.
Diese Abhängigkeit von US-Konzernen bedeutet jedoch nicht, dass sie keiner Kritik ausgesetzt wären. In Europa wird US-Plattformen häufig eine neoliberale, profitorientierte Haltung vorgeworfen, die manche als Bedrohung für europäische Institutionen ansehen (Van Dijck, 2020). Der Vorwurf lautet: Indem sie Unternehmensinteressen über öffentliche Verantwortung stellen, haben diese Firmen übermäßige Marktmacht erlangt. Sie sammeln Daten, steuern Algorithmen und prägen damit zentrale digitale Infrastrukturen.
In jüngster Zeit beginnen europäische Politiker*innen und politische Entscheidungsträger*innen, die Abhängigkeit der EU von ausländischen Technologien in Schlüsselbereichen wie Internet und Telekommunikation kritisch zu hinterfragen. Schätzungen zufolge stammen über 80 % der digitalen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen und geistigen Eigentumsrechte in der EU von nicht-europäischen Anbietern. Das bedeutet: Der Großteil der Software, Apps und digitalen Werkzeuge, die Europäer*innen nutzen, wird außerhalb Europas entwickelt. Die Fähigkeit, eigene digitale Technologien zu schaffen, ohne auf ausländische Unternehmen angewiesen zu sein, ist daher zu einem zentralen Thema der europäischen Digitalpolitik geworden. Zahlreiche Initiativen wurden gestartet – doch es bleibt unklar, welchen Weg Europa einschlagen und welche Dienste es vorrangig ersetzen, fördern oder weiterentwickeln sollte.
Dieser Wendepunkt eröffnet zugleich eine breitere Debatte darüber, welche Art von Plattformökonomie und Gesellschaft Europa künftig gestalten möchte. Er signalisiert den Anspruch, ein digitales Modell zu entwickeln, das sich deutlich von denen in den USA und China unterscheidet. Statt bestehende Plattform-Geschäftsmodelle zu kopieren, zielt das europäische Bestreben darauf ab, eine Plattformökonomie zu schaffen, die gegenüber Verbraucher*innen, Unternehmen und Beschäftigten stärker rechenschaftspflichtig ist (Graef & Bostoen, 2025). Dazu gehören transparentere Datennutzungspraktiken, nachvollziehbare Preisbildungsmechanismen sowie Empfehlungs- und Ranking-Systeme, ein fairer Wettbewerb ohne Selbstbevorzugung und verbesserte Arbeitsbedingungen für Plattformbeschäftigte durch faire Bezahlung und garantierte Rechte.
Fazit
Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass der Aufbau nationaler Plattformalternativen ein komplexer, langfristiger Prozess ist, der von den Fähigkeiten der Unternehmen, den Marktbedingungen und politischen Entscheidungen geprägt wird. China und Russland konnten auf früh entstandene einheimische Marktführer setzen, während Indien versucht, die Macht US-amerikanischer Plattformen neu zu verteilen und eine gerechtere digitale Infrastruktur aufzubauen.
Europa steht mit seinem eigenen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld vor anderen Herausforderungen. Bevor in Alternativen investiert wird, braucht es ein gemeinsames Verständnis darüber, warum Europa solche Wege einschlagen sollte, welche Dienste und Sektoren als strategisch gelten und zu welchem Zweck sie gefördert werden sollen. Erst dann kann Europa einen klaren und kohärenten Kurs einschlagen, um eine Plattformökonomie zu gestalten, die den eigenen Werten und Prioritäten entspricht – eine Ökonomie, die zugleich demokratisch und wettbewerbsfähig ist.
Referenzen
Van Dijck, J. (2020). Governing digital societies: Private platforms, public values. Computer law & security review, 36, 105377. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105377
Lehdonvirta, V., Park, S., Krell, T., & Friederici, N. (2020). Platformization in Europe: Global and local digital intermediaries in the retail, taxi and food delivery industries.
Graef, I., & Bostoen, F. (2025). A typology of platform power and its regulation. Information, Communication & Society, 1-15.
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autor*innen und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Plattform Governance
Der Human in the Loop bei der automatisierten Kreditvergabe – Menschliche Expertise für größere Fairness
Wie fair sind automatisierte Kreditentscheidungen? Wann ist menschliche Expertise unverzichtbar?
Gründen mit Wirkung: Für digitale Unternehmer*innen, die Gesellschaft positiv gestalten wollen
Impact Entrepreneurship braucht mehr als Technologie. Wie entwickeln wir digitale Lösungen mit Wirkung?
Bias erkennen, Verantwortung übernehmen: Kritische Perspektiven auf KI und Datenqualität in der Hochschulbildung
KI verändert Hochschule. Der Artikel erklärt, wie Bias entsteht und warum es eine kritische Haltung braucht.