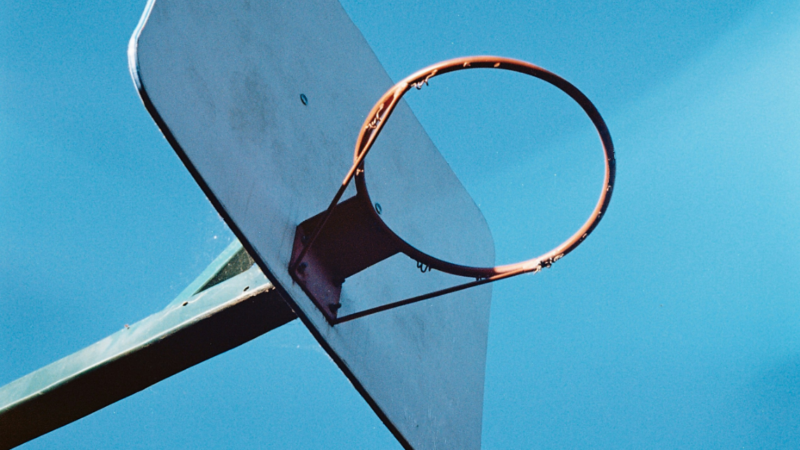Unsere vernetzte Welt verstehen

Europas Desinformationsforschende verteidigen
Forschende, die in Europa zu Desinformation arbeiten, werden verklagt, belästigt und öffentlich diffamiert, nur weil sie ihrer Aufgabe nachgehen. Ziel dieser Angriffe ist es, jene zum Schweigen zu bringen, die digitale Plattformen kritisch untersuchen und das Fehlverhalten politischer Akteure offenlegen. Aktuelle Beispiele reichen von einer Verleumdungsklage in Frankreich über Diffamierungskampagnen in Polen bis hin zu staatlichem Druck auf Forschungseinrichtungen in Lettland und Ungarn. Diese Vorfälle sind keine Einzelfälle. Sie folgen einer koordinierten Strategie, die ihren Ursprung in extremistischen Kreisen der Vereinigten Staaten hat und inzwischen auf Europa übergreift. Damit geraten die demokratischen Werte der Europäischen Union zunehmend unter Druck. Der Artikel analysiert die unterschiedlichen Angriffsmuster gegen Desinformationsforschende, erläutert ihre Funktionsweisen und Ursprünge und zeigt auf, wie die Europäische Union darauf reagieren kann. Es ist an der Zeit, diejenigen zu schützen, die die Öffentlichkeit vor Propaganda, Falschinformationen und gezielter Einflussnahme bewahren.
In vielen europäischen Ländern geraten Forschende und zivilgesellschaftliche Organisationen zunehmend ins Visier von Angriffen. Ähnliche Muster sind bereits aus den Debatten um Klimaforschung bekannt, ebenso aus der Arbeit von Journalist*innen oder von Wissenschaftler*innen, die zu Themen wie Geschlecht oder Identität forschen. Weniger Aufmerksamkeit erfahren bislang diejenigen, die Desinformation untersuchen, obwohl sie eine Schlüsselrolle dabei spielen, manipulative Informationspraktiken sichtbar zu machen und damit die demokratischen Institutionen Europas zu stärken.
Diese Vorfälle wirken auf den ersten Blick wie voneinander unabhängige Ereignisse. Bei genauerem Hinsehen lassen sich jedoch Parallelen zu Vorgehensweisen erkennen, die zunächst in den Vereinigten Staaten entwickelt und angewandt wurden. Sie zielen darauf ab, das Vertrauen in Institutionen zu schwächen, die schädliche Inhalte im Netz überwachen und aufdecken. Mit der Verbreitung solcher Methoden nach Europa hat sich auch hier der Rahmen politischer Debatten verschoben. Grundlegende Prinzipien wie Transparenz, Rechenschaftspflicht und Wahrheitsorientierung stehen zunehmend unter Druck, während extremistische Akteure und propagandistische Narrative an Einfluss gewinnen.
Warum Desinformationsforschung wichtig ist
Gerade deshalb ist die Arbeit der Desinformations-Expert*innen unverzichtbar. Forschende analysieren Inhalte in sozialen Medien, decken koordinierte Belästigungskampagnen auf, untersuchen automatisierte Bot-Aktivitäten, kartieren Einflussnetzwerke und verfolgen die Entwicklung von Erzählungen rund um Wahlen, Konflikte, öffentliche Gesundheit oder Klimawandel. Zahlreiche Universitäten, Nichtregierungsorganisationen für Faktenprüfung, investigative Medien und Kooperationen wie das European Digital Media Observatory oder das European Fact-Checking Standards Network arbeiten eng zusammen, um manipulative Informationspraktiken offenzulegen. Zugleich vermitteln sie der Öffentlichkeit die Kompetenzen, die notwendig sind, um sich in einer komplexen und unübersichtlichen Informationslandschaft zurechtzufinden.
Angesichts zunehmender Bedrohungen durch ausländische Einflussnahme und innerstaatlichen Extremismus ist diese Forschung für Demokratien von zentraler Bedeutung. Denn: Entwicklungen im digitalen Raum bleiben nicht folgenlos für das gesellschaftliche Leben. Die Analyse und Offenlegung dieser Muster ist entscheidend, um Vertrauen in demokratische Verfahren zu sichern und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
Ein wachsendes Angriffsmuster
In den Vereinigten Staaten entstand nach der Präsidentschaftswahl 2020 eine Kampagne, die gezielt Desinformationsforschende und -institutionen ins Visier nahm. Auslöser waren unbelegte Behauptungen, große Technologieunternehmen hätten die Wahl gegen Präsident Trump manipuliert und konservative Stimmen in sozialen Medien zum Schweigen gebracht. Obwohl für diese Vorwürfe keinerlei Beweise vorliegen, fanden sie rasch große Resonanz. In der Folge richteten sich Angriffe gegen Forschungsprojekte sowie gegen Wissenschaftler*innen, die als sogenannte ‘Trusted Flaggers’ Social-Media-Plattformen über illegale Inhalte oder Verstöße gegen Nutzungsbedingungen informiert hatten.
Das Ziel dieser Kampagne war es, die Forschenden fälschlich als staatliche Zensoren darzustellen. Die Angriffe verstärkten sich durch politisch motivierte Anhörungen im Kongress, durch eine breite mediale Aufmerksamkeit, insbesondere im Zusammenhang mit den sogenannten „Twitter Files“, durch eine Serie von Klagen und durch finanzielle Unterstützung aus politisch interessierten Kreisen. Dadurch entstand ein zunehmend feindliches rechtliches und politisches Umfeld, das die Arbeit der Forschenden erheblich erschwerte. Verstärkt wurden diese Entwicklungen durch das „House Weaponization Subcommittee“ sowie durch Verfahren wie Missouri v. Biden, das schließlich mangels Beweisen vom Obersten Gerichtshof abgewiesen wurde.
Heute sind Angriffe auf Desinformationsforschende, auf Universitäten und auf Unternehmen, die sich aktiv gegen Desinformation engagieren, in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Sie reichen bis in höchste Regierungsebenen hinein und verdeutlichen die Risiken für die demokratische Kultur und demokratischen Rückschritt.
Zielscheibe Desinformationsforschende
Auch in Europa haben die Angriffe auf Desinformationsforschende in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen. Einige Beispiele machen dies sichtbar:
- In Frankreich musste sich ein Forscher wegen einer Verleumdungsklage vor Gericht verantworten, nachdem er öffentlich auf ausländische Einflussnetzwerke hingewiesen hatte. Das Gericht entschied schließlich zu seinen Gunsten.
- In Polen wurden Mitarbeitende des Instituts NASK nach ihren Analysen im Wahljahr 2025 öffentlich koordiniert angegriffen und ihnen wurde vorgeworfen, voreingenommen zu sein und ausländischen Interessen zu folgen.
- In Lettland richtete die Regierung offizielle Anfragen an die NGO Re:Baltica, nachdem diese 2025 Recherchen zu Wahlinterventionen und Parteienfinanzierung veröffentlicht hatte. Die Fragen betrafen insbesondere die Finanzierung der Organisation und die Auswahl ihrer Untersuchungsthemen.
- In Ungarn wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der Faktenchecker*innen, Organisationen zur Bekämpfung von Desinformation sowie deren Geldgeber als „ausländische Agenten“ klassifiziert. Dies hätte zur Folge, dass ihnen staatliche Förderung entzogen wird und sie auf Beobachtungslisten erscheinen.
Ein transatlantisches Drehbuch
Diese europäischen Fälle ähneln Strategien, die bereits in den Vereinigten Staaten angewandt werden. Dort geraten Forschende durch juristische Schikanen, Rufschädigung und den Vorwurf angeblicher Zensur zunehmend unter Druck, insbesondere von rechtsextremen Influencer*innen und Politiker*innen.
In diesem Kontext hat sich die in den USA weit verbreitete Erzählung vom sogenannten „Zensur-Industrie-Komplex“ etabliert. Sie zeichnet Forschende, Journalist*innen sowie Akademiker*innen als Teil einer elitären Verschwörung dar, die konservative oder abweichende politische Meinungen unterdrücke. Diese Rhetorik greift inzwischen auch in Europa um sich und wird hier eingesetzt, um von der Europäischen Union unterstützte Faktenprüfungsinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen zu diskreditieren.
Typologie der Angriffe
Um wirksam reagieren zu können, ist es notwendig, die unterschiedlichen Angriffsmuster genauer zu verstehen. Aktuelle Fälle in Europa und den Vereinigten Staaten lassen sich in mehrere Kategorien einordnen.
- Strategische Klagen und rechtlicher Druck: In Frankreich wurde beispielsweise eine SLAPP-Klage (strategic lawsuit against public participation) gegen einen Forscher erhoben. In den Vereinigten Staaten wurden Forschende aus Stanford und von der University of Washington mehrfach verklagt, mussten vor Gericht erscheinen und vor politisch motivierten Anhörungen des Kongresses aussagen. In der Folge stellte Stanford das Internet Observatory ein.
- Politisierte Diffamierungskampagnen: Re:Baltica wurde nach kritischen Recherchen durch eine Regierungsanfrage unter Druck gesetzt. In den USA wurden Forscher „gedoxxt“ (private Daten veröffentlicht) und verloren ihre Finanzierung, wenn sie das Thema Desinformation behandelten. Die Trump-Regierung drohte offen, die private Finanzierung vermeintlicher Gegner, darunter Forschungseinrichtungen, zu untersuchen.
- Umkehr von Meinungsfreiheit: Ungarische NGOs wurden beschuldigt, die nationale Souveränität zu untergraben, weil sie Falschinformationen und Korruption entlarvten. In den USA wurden Einrichtungen wie das Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council oder Graphika von der Trump-Administration als Unterdrücker freier Meinungsäußerung dargestellt, obwohl sie lediglich Einflussnetzwerke dokumentierten. In einem bekannten Fall hätten diese Institutionen solchen falschen Behauptungen zufolge 22 Millionen Tweets „zensiert“, obwohl sie diese in Wahrheit nur untersucht hatten.
- Koordinierte Online-Belästigung: Forscher bei NASK wurden mit Namen und Gesicht identifiziert, ihre persönlichen Daten veröffentlicht – mit massiver Belästigung nach der Wahl 2025 in Polen. In den USA war Nina Jankowicz nach ihrer Ernennung in das „Disinformation Governance Board“ des Heimatschutzministeriums extremem Online-Missbrauch und Drohungen ausgesetzt, was schließlich zur vorzeitigen Auflösung des Gremiums führte.
Diese Taktiken bilden ein klar erkennbares Handbuch, das sich leicht auf unterschiedliche politische Umgebungen übertragen lässt. Ihr Effekt: Desinformationsforschung wird beruflich riskant und politisch brisant. In der EU sind die Vorfälle Teil einer strategischen Verschiebung: Ihr Zweck besteht zunehmend weniger darin, Forschungsergebnisse inhaltlich zu entkräften, sondern vielmehr darin, die Glaubwürdigkeit von Forschenden und Institutionen selbst grundsätzlich infrage zu stellen. Dadurch werden wichtige Aufklärungsarbeiten, dazu, wer beispielsweise von Desinformation profitiert, verzögert oder blockiert. Selbst wenn Klagen oder Verfahren gegen Desinformationsforschende am Ende erfolglos bleiben, entstehen für die Betroffenen erhebliche Kosten, Zeitverluste und Belastungen, die ihre Arbeit erheblich erschweren.
Wie Europa reagieren sollte
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sollten die Institutionen der Europäischen Union, die nationalen Regierungen und zivilgesellschaftliche Förderorganisationen abgestimmt vorgehen und eine koordinierte Verteidigungsstrategie entwickeln. Dafür bieten sich mehrere konkrete Schritte an:
- Anti-SLAPP-Gesetze: Die EU-Kommission schlug im April 2022 eine Anti-SLAPP-Richtlinie gegen missbräuchliche grenzüberschreitende Klagen vor. Die Mitgliedstaaten sollten die Umsetzung beschleunigen und den Schutz ausdrücklich auf Desinformationsforschende und NGOs im öffentlichen Interesse ausweiten.
- Rechtliche Notfallunterstützung: Die EU-Kommission sollte gemeinsam mit dem EFCSN ein schnelles Rechtsbeistands-Programm schaffen – ähnlich dem Legal Support Program des ECPMF. So könnten Forscher bei Verleumdungsklagen sofortige Beratung und Kostendeckung erhalten. In den USA arbeiten Organisationen wie das American Sunlight Project bereits an ähnlichen Mechanismen.
- Schutzklauseln in Förderprogrammen: Förderprogramme wie Horizon Europe und CERV sollten explizit garantieren, dass Institutionen ihre grantees bei Reputations- oder Rechtsangriffen unterstützen. Stiftungen wie die Knight Foundation bieten solche Schutzmechanismen in den USA bereits an.
Die Verteidiger*innen verteidigen
Forschende, die Desinformation untersuchen, sind für das Funktionieren der Demokratie, für faire Wahlen, für die öffentliche Gesundheit und eine sachliche Debattenkultur unverzichtbar. Die Angriffe, denen sie ausgesetzt sind, sind daher nicht einfach Ausdruck politischer Meinungsverschiedenheiten, sondern bewusst eingesetzte Strategien, die Wahrheit und Demokratie selbst untergraben sollen. Damit werden Desinformationsforschende in Kulturkämpfe hineingezogen, die sie nicht selbst begonnen haben. Sie werden nicht wegen politischer Überzeugungen angegriffen, sondern weil ihre empirische Arbeit unbequeme Fakten sichtbar macht.
Die Angriffe auf beiden Seiten des Atlantiks verdeutlichen, dass hier eine globale Bedrohung für demokratische Rechenschaftspflicht vorliegt. Europa kann es sich nicht leisten, diese Informationswächter*innen zu verlieren. Wer sie nicht schützt, stärkt nicht nur ihre Gegner*innen, sondern riskiert auch eine Schwächung der demokratischen Infrastruktur insgesamt. Es ist daher höchste Zeit, die Verteidiger*innen zu schützen – durch klare Gesetze, durch wirksame politische Maßnahmen und den Rückhalt der Öffentlichkeit.
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autor*innen und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Themen im Fokus
Der Human in the Loop bei der automatisierten Kreditvergabe – Menschliche Expertise für größere Fairness
Wie fair sind automatisierte Kreditentscheidungen? Wann ist menschliche Expertise unverzichtbar?
Gründen mit Wirkung: Für digitale Unternehmer*innen, die Gesellschaft positiv gestalten wollen
Impact Entrepreneurship braucht mehr als Technologie. Wie entwickeln wir digitale Lösungen mit Wirkung?
Bias erkennen, Verantwortung übernehmen: Kritische Perspektiven auf KI und Datenqualität in der Hochschulbildung
KI verändert Hochschule. Der Artikel erklärt, wie Bias entsteht und warum es eine kritische Haltung braucht.