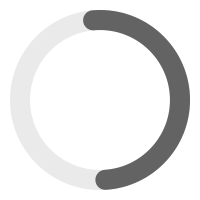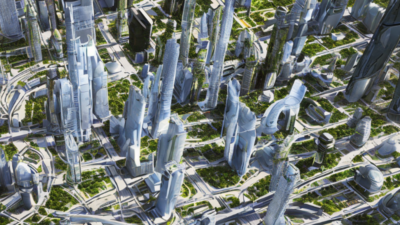Forschungsthema im Fokus
Offene Hochschulbildung
Offene Bildung (Open Education) verfolgt das Ziel, Wissen in verschiedenen Gemeinschaften zu teilen und den Zugang zu Bildung zu erweitern. Das gilt für jeden Menschen, unabhängig vom Hintergrund, digitalen Fähigkeiten, Finanzen oder Wohnort. In diesem Kontext spielen Universitäten, Verlage und Bibliotheken eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung des Zugangs zu Wissen und offenen Bildungsressourcen. In unserer Forschung zur offenen Bildung untersuchen wir diese Schlüsselakteure, ihre Praktiken und suchen nach einer gerechteren Zukunft für die Bildungstechnologie im Kontext sich entwickelnder Trends und Lösungen.
In einer idealen Welt dient Bildung als Brückenbauer und ein großer Ausgleichsfaktor. In dieser bringt sie unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammen, um kollektiv daran zu arbeiten, Wissen zu erweitern, Bildungstechnologien (im Englischen: Educational Technology oder EdTech) und offene Bildung haben das Potenzial, zu diesem Ziel beizutragen. Sie ermächtigen Menschen jederzeit und überall auf Bildungsressourcen zuzugreifen.
Zugang zu Bildungstechnologien
Obwohl es potenziell unzählige Bildungswerkzeuge und -lösungen gibt, haben nicht alle aufgrund verschiedener Gründe den gleichen Zugang zu ihnen. Nicht alle Schüler*innen verfügen beispielsweise über die notwendigen technischen Ressourcen wie Computer oder Tablets. Auch können sie sich die Kosten für EdTech-Tools nicht leisten. Ebenso variieren bei einzelnen Lehrkräften die digitale Kompetenz, die technische Expertise und die pädagogischen Fähigkeiten, um einen digitalen Unterricht erfolgreich gestalten zu können. Zudem unterscheiden sich Institutionen in den Ressourcen, die sie für den Online-Unterricht und die Infrastruktur offener Bildung bereitstellen können, einschließlich Finanzierung und IT-Dienstleistungen.
Daher können neu aufkommende Bildungstechnologien unbeabsichtigt die Unterschiede zwischen denjenigen mit Zugang und ohne Zugang zu digitalen Bildungsressourcen verschärfen – und das, obwohl sie angeblich Ungleichheiten verringern sollen.
Offene Hochschulbildung
Am HIIG vertreten wir die Ansicht, dass Bildungstechnologie und offene Bildung Hand in Hand gehen. Obwohl frei verfügbare Technologie (Open Access) vor zahlreichen Herausforderungen steht, hat sie das Potenzial, Menschen miteinander zu verbinden. Unser Hauptaugenmerk liegt hierbei auf offener Bildung, insbesondere im Bereich der Hochschulbildung und des Wissenschaftssystems. Wir wollen Institutionen und Einzelpersonen mit den nötigen Werkzeugen und dem Wissen ausstatten, damit sie die Einsatzmöglichkeiten von offenen Bildungsressourcen und -methoden voll ausschöpfen.
Unsere Forschung untersucht, wie wir die Chancen für alle erhöhen können,von offenen Bildungsressourcen und -technologien zu profitieren. Und das unabhängig von ihrem Hintergrund. Dazu gehört die Erforschung aktueller Trends in der Bildungstechnologie, das Aufdecken von Ungleichheiten innerhalb wissenschaftlicher Praktiken und das Untersuchen der Erfahrungen von Pädagog*innen, Schüler*innenn und anderen Bildungsfachleuten. Wir untersuchen auch verschiedene Bildungstechnologiewerkzeuge und Online-Formate und betonen Open-Source-Methoden zur Wissensverbreitung.
Aktuell erkunden wir, wie Hochschulen Bildungstechnologie für eine verbesserte Wissensvermittlung nutzen können. Zudem entwickeln wir kontinuierlich offene Bildungsressourcen und Leitfäden für Praktiker*innen.
Darüber hinaus glauben wir, dass gemeinsame Bemühungen unerlässlich sind, um die Herausforderungen der offenen Bildung zu bewältigen. Aus diesem Grund untersuchen wir im Forschungsprojekt "Scholar-led Plus" nachhaltige Verlagsinfrastrukturen für Open-Access-Zeitschriften. Viele unserer Initiativen sehen enge Partnerschaften mit Schlüsselpraktiker*innen, Branchenexpert*innenund anderen Stakeholdern vor, um Best Practices und Lösungen für eine offene Bildung zu entwickeln und umzusetzen.
Digital & Disziplinlos
Digitalisierung und Bildung
Welche Chancen bietet uns die digitale Bildung in der Zukunft? Unser assoziierter Forscher Dr. Benedikt Fecher geht dieser komplexen Frage nach.
Open Educational Resource
Making Sense of the Future
Wie können wir unsere digitale Zukunft verstehen? Erfahren Sie mehr über unser Toolkit "Making sense of the Future", das digitales Lernen auf spielerische Art und Weise angeht.
Digitaler Salon
Chatbot potentia est!
Warum sollten wir ChatGPT vielleicht mit Vorsicht genießen und wie können wir in Zukunft mit antrainierten Verzerrungen und falschen Daten umgehen? Wir diskutieren in dieser Ausgabe des Digitalen Salons.
Wissenschaftsfeindlichkeit: Was wir wissen und was wir gegen sie tun können
Das KAPAZ-Projekt unterstützt Forschende bei Wissenschaftsfeindlichkeit mit Kommunikationstraining, institutioneller Hilfe und Sensibilisierungsmaßnahmen.
Debunking Science Myths: Vorurteile über Wissenschaft und was wirklich dran ist
Was ist an Vorurteilen gegenüber Wissenschaft wirklich dran? Fünf populäre Mythen über eine ständig streitende Berufsgruppe einfach erklärt.
Making Sense of the Future: Neue Denksportaufgaben für digitale Zukünfte im Unterricht
"Making Sense of the Future" ist ein Werkzeugkasten, der Zukunftsforschung und Kreativität kombiniert, um digitale Zukünfte neu zu gestalten.
Liebling, wir müssen über die Zukunft sprechen
Können Zukunftsstudien den Status quo jenseits der akademischen Welt in Frage stellen und den öffentlichen Dialog als fantasievollen Raum für kollektive Unternehmungen nutzbar machen?
Diamond OA: Für eine bunte, digitale Publikationslandschaft
Der Blogpost macht auf neue finanzielle Fallstricke in der Open-Access-Transformation aufmerksam und schlägt eine gemeinschaftliche Finanzierungsstruktur für Diamond OA in Deutschland vor.
Mein Roboter hat meine Hausarbeit geschrieben: KI-Anwendungen und Kreativität an der Universität
Ist KI ein Kreativitätskiller? Wir überlegen, ob und wie generative KI dazu eingesetzt werden kann, Kreativität an Universitäten zu fördern.