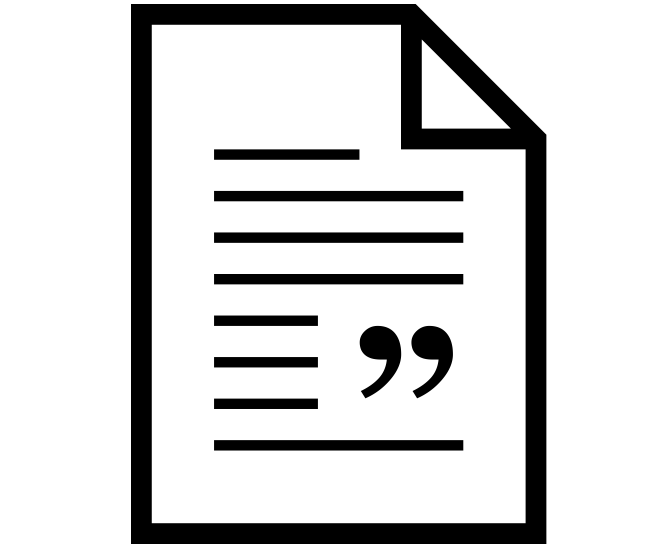Die vorliegende Studie präsentiert die Ergebnisse einer dreijährigen Begleitforschung zu den
vom Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt (BMFTR) geförderten „Projekten
zur Entwicklung und praktischen Erprobung von Datentreuhandmodellen in den Bereichen
Forschung und Wirtschaft“. Datentreuhänder sind in diesem Zusammenhang als intermediäre
Strukturen zu verstehen, die den technisch-organisatorischen Austausch von Daten zwischen
Datengebenden und -nutzenden bewerkstelligen.
Im Rahmen der Begleitforschung erfolgte zunächst eine Bestandsaufnahme der geförderten
Pilotprojekte und anderer Anwendungsbeispiele sowie der wissenschaftlichen Literatur zur
möglichen Rolle von Datentreuhändern in Datenökosystemen. Darauf aufbauend identifizierte
und systematisierte die Begleitforschung zentrale Herausforderungen und erste Lösungsansätze
für den Aufbau und Betrieb von Datentreuhändern. Die Analyse der eigens erhobenen Daten
sowie die konzeptionellen Arbeiten der Begleitforschung orientierten sich dabei an vier
Querschnittsthemen, die in ihrer Wechselwirkung untersucht wurden: 1. Technische Infrastruktur,
2. Rechtliche Rahmenbedingungen, 3. Geschäfts- und Betriebsmodellentwicklung sowie
4. Akzeptanz, Standardisierung, Zertifizierung und Skalierung. Die Befunde der Begleitforschung
sowie die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen richten sich nicht nur an bestehende
und künftige Betreiber von Datentreuhändern, sondern auch an politische
Entscheidungsträger und Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft, die
am Aufbau einer funktionsfähigen Datenökonomie beteiligt sind. Daneben richtet sich die
Studie an alle Interessierten an der Schnittstelle von Forschung, Innovation und Digitalisierung.
Ausgangshypothese der Begleitforschung war, dass Daten aufgrund eines ungünstigen Wert-
Risiko-Verhältnisses nur begrenzt innerhalb und zwischen Sektoren (Wissenschaft, Wirtschaft)
geteilt werden, auch wenn das vermehrte Teilen von Daten aus gesamtgesellschaftlicher und
insbesondere innovationspolitischer Sicht wünschenswert wäre. Demnach schrecken
potenzielle Datengebende oftmals davor zurück, ihre Daten zu teilen, da sie einen
Kontrollverlust bezüglich der weiteren Verwendung dieser Daten fürchten. Außerdem halten
vermeintliche und tatsächliche Compliance-Risiken Datengebende und Datennutzende
gleichermaßen in vielen Fällen vom Datenteilen ab. Gleichzeitig ist der mögliche Wert, der sich
sowohl für Datengebende als auch -nutzende aus dem Datenteilen ergeben kann, oftmals
schwer zu bemessen. Diesen Umstand fasst die Begleitforschung unter dem Begriff Wert-Risiko-
Dilemma zusammen.
Als neutrale Instanzen haben Datentreuhänder das Potenzial, einen fairen Interessensausgleich
zwischen Datengebenden und -nutzenden zu ermöglichen, gegebenenfalls neue
Vertrauensbeziehungen anzubahnen und den technisch-organisatorischen Zugang zu
qualitativ hochwertigen Daten unter Wahrung des Datenschutzes sowie der Interoperabilität
zu garantieren. Diese These lässt sich anhand der konzeptionellen Überlegungen theoretisch
und in Anbetracht der empirischen Befunde praktisch validieren. Theoretisch lässt sich
herleiten, dass Datentreuhänder den Wert des Datenteilens positiv beeinflussen und das damit
einhergehende Risiko des Kontrollverlusts über die geteilten Daten für die Datengebenden
sowie Compliance-Risiken für Datengebende und -nutzende senken können. Voraussetzung
dafür ist, dass Datentreuhänder Vertrauen zwischen Datengebenden und -nutzenden schaffen
und sich selbst als vertrauenswürdige Akteure platzieren, dass sie rechtliche Unsicherheiten
reduzieren und Mehrwerte für Datengebende und -nutzende ermöglichen.
Die empirischen Auswertungen der Begleitforschung führen zu folgenden Kernbefunden:
Die BMFTR-geförderten Pilotprojekte konnten insbesondere technische und rechtliche
Anforderungen an den Aufbau von Datentreuhändern in verschiedenen Domänen
identifizieren und entsprechende Lösungsansätze erproben. Gleichzeitig bestätigen die in den
Pilotprojekten aufgeworfenen Fragen und weiteren Befunde der Begleitforschung, dass
bestimmte technische, rechtliche und wirtschaftliche Herausforderungen einem breiten Einsatz
Datentreuhänder als Schlüssel zum Datenteilen: Ansätze, Herausforderungen und Empfehlungen für die Umsetzung v
von Datentreuhändern derzeit noch entgegenstehen. Lösungsansätze für einige dieser
Herausforderungen konnten von der Begleitforschung, wie im Folgenden dargestellt, empirisch
identifiziert und konzeptionell weiterentwickelt werden.
Zunächst ist festzustellen, dass Datenteilen vor allem dann für Datengebende und -nutzende
interessant ist, wenn konkrete und wertvolle Anwendungsfälle für die so geteilten Daten klar
erkennbar sind. Für den Erfolg von Datentreuhändern ist es daher aus Sicht der Begleitforschung
essenziell, dass diese die relevanten Datenbestände, Branche(n), Technologien, Märkte,
Geschäftsmodelle und Kulturen der Akteure im Datenökosystem sehr gut kennen. Außerdem
sollten sie ein gewisses Standing bei den relevanten Akteuren haben, um akzeptiert zu werden.
Dies wiederum hat Implikationen für die zu wählende Geschäftsstrategie und mögliche
Skalierung des jeweils gewählten Datentreuhandmodells.
Aus rechtlicher Sicht ist durch die Betreiber von Datentreuhändern zunächst zu klären, wer über
den Zugriff auf und die Verwendung von zu teilenden Daten bestimmt und welche
Compliance-Risiken sich hieraus für Datengebende und -nutzende ergeben. Aus rechtlicher
Sicht ist eine wesentliche Funktion von Datentreuhandmodellen, die Compliance-Risiken der
Datenteilenden sowie die mit der Kontrolle dieser Risiken üblicherweise verbundenen Kosten zu
reduzieren. Vor diesem Hintergrund entwickelte die Begleitforschung eine Typologie von
Datentreuhandmodellen, welche Fallgruppen nach der Intensität der Compliance-Risiken und
dem erforderten Umfang an Kontrollmechanismen klassifiziert. Je nach Risiko können die Daten
entweder der Allgemeinheit als offene Daten bereitgestellt, nur bestimmten
vertrauenswürdigen Datennutzenden zugänglich gemacht oder gar nicht als Rohdaten,
sondern ausschließlich in Form von darauf aufbauenden Analyseergebnissen zwischen
Datengebenden und -nutzenden geteilt werden. Einem Datentreuhänder kommt dann die
Funktion zu, die entsprechenden rechtlichen, technischen und organisatorischen
Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiger Begriff, der diese Infrastrukturen
beschreibt, sind die sogenannten sicheren Datenverarbeitungsumgebungen.
Ein zentraler Befund der Begleitforschung ist es, dass der aktuelle auf das Teilen von Daten
zugeschnittene deutsche wie europäische Rechtsrahmen (insbesondere der Data
Governance Act bzw. DGA) zwar wichtige Schritte in Richtung vertrauensfördernder
Infrastrukturen macht. Um vor allem die Rechtssicherheit für Datengebende und -nutzende
sowie Datentreuhänder in der Praxis ui erhöhen, müsste der Rechtsrahmen allerdings noch
stringenter und konsistenter auf dieses Ziel ausgerichtet werden. Denn die Rechtssicherheit zeigt
sich in den Pilotprojekten sichtbar als ein Hemmnis für den Aufbau von Datentreuhändern und
Datenökosystemen. Die von der Begleitforschung auf empirischer Basis konzeptionell
aufgestellten Fallgruppen können dabei helfen, das je nach Intensität der jeweils vorliegenden
Risiken und möglichen Interessenskonflikte zwischen Datengebenden und -nutzenden am
besten geeignete Datentreuhandmodell zu identifizieren.
Aus den rechtlichen Anforderungen für Datentreuhandmodelle lassen sich technische
Bausteine für deren Umsetzung ableiten. Diese Bausteine bilden das fundamentale Gerüst, um
den vertrauensvollen Austausch und die Nutzung von Daten zu ermöglichen. Auch wenn die
konkrete Ausgestaltung je nach Anwendungsfeld variieren kann, müssen Datentreuhänder
dabei jedoch immer bestimmte Anforderungen in Bezug auf Interoperabilität, Datensicherheit
und Datenminimierung erfüllen, um sich am Markt etablieren zu können. Interoperabilität
bezieht sich hierbei auf Schnittstellen und Datenmodelle für eine reibungslose
Datenübertragung. Unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit müssen geeignete
Maßnahmen für die Authentifizierung, Autorisierung, Protokollierung, Datenverschlüsselung und
Zertifizierung ergriffen werden. Datenminimierung bezieht sich darauf, dass nur jene
Informationen offengelegt werden, die für den jeweiligen Anwendungsfall unabdingbar sind.
Die Begleitforschung präsentiert einen Baukasten, der je nach Anwendungsfall geeignete
Bausteine zur Erfüllung dieser zentralen Anforderungen enthält.
Daneben spielen technische, rechtliche und organisatorische Standards bei der erfolgreichen
Etablierung von Datentreuhändern eine Rolle. Es zeigt sich, dass Vertrauen nicht allein durch
Datentreuhänder als Schlüssel zum Datenteilen: Ansätze, Herausforderungen und Empfehlungen für die Umsetzung vi
die Wahl geeigneter technischer Bausteine entsteht, sondern meist nur im Zusammenhang mit
transparenten Prozessen, Zertifizierungen, glaubwürdigen Betreibern und partizipativen
Governance-Strukturen. Insgesamt steht die Entwicklung von Standards sowohl für
Daten(teilen) als auch für Datentreuhänder noch am Anfang. Die Begleitforschung konnte in
den untersuchten Pilotprojekten verschiedene Ansätze zur Standardisierung des
Datenaustauschs identifizieren, insbesondere im Bereich Medizin- und Gesundheitsforschung
sowie in der Forstwirtschaft. Auf Standards können wiederum Zertifizierungen aufgesetzt
werden, die Governance, Finanzierung, Datenzugangsregeln, Datensicherheit, Ethik und
Nachhaltigkeit sowie Qualität der durch einen Datentreuhänder geteilten Daten ausweisen.
Entsprechende Maßnahmen werden von den Pilotprojekten für wünschenswert gehalten,
finden sich jedoch bislang noch nicht in der Praxis. Die aktuell unzureichende Verfügbarkeit
allgemein akzeptierter Standards für Daten, Datenteilen und Datentreuhänder stellt eine Hürde
sowohl für die weitere Entwicklung der einzelnen Datentreuhänder als auch für eine stärkere
Interoperabilität zwischen verschiedenen Datentreuhändern dar. Als vergleichsweise wichtige
Entwickler standardisierter Komponenten haben z. B. Gaia-X und die International Data Spaces
Association aber auch andere Datenrauminitiativen und -technologien wie SOLID (Social
Linked Data) mittelfristig das Potenzial, die Entwicklung zu stärkerer Interoperabilität zu
unterstützen.
Auch die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle für den langfristigen Betrieb von Daten-
treuhändern gestaltet sich in der Pilotprojekt-Praxis herausfordernd. Es bestehen Unsicherheiten
bei der Bepreisung von Daten, der langfristig tragfähigen Finanzierung von Datentreuhändern
sowie bei der Wahl eines geeigneten Betriebsmodells für diese. Grundsätzlich sind die
wenigsten Betreiber eines Datentreuhänders rein monetär motiviert – vielmehr hoffen diese
meist, neue datenbasierte Anwendungsfälle zu ermöglichen, die wiederum ihnen und anderen
Akteuren im Datenökosystem zugutekommen. Dennoch müssen die Kosten für den Betrieb
eines Datentreuhänders zumindest gedeckt werden. Dies kann sowohl mittels for-profit- als
auch über non-profit-Modelle organisiert werden. Je nach Anwendungsdomäne wird von den
Pilotprojekten eine öffentliche Trägerschaft bevorzugt, etwa in der Domäne der
Medizinforschung, oder aber privatwirtschaftliche Träger, wie etwa in der Energiebranche oder
der Wohnungswirtschaft. Bei der Finanzierung des Datentreuhänders werden von den
Pilotprojekten tendenziell Abonnementmodelle gegenüber transaktionsbasierten pay-per-use-
Ansätzen bevorzugt.
Eine europaweite sowie domänenübergreifende Skalierung von Datentreuhandmodellen ist
derzeit noch kaum absehbar, wird jedoch von an Datentreuhändern beteiligten Akteuren für
wünschenswert erachtet. Skalierung wird dabei von diesen eher als Zusammenschluss
föderierter, aber eigenständiger Datentreuhänder verstanden, denn als Expansion einzelner
Datentreuhänder in neue geografische oder sektorale Märkte. Die technische Interoperabilität
von Datentreuhändern – etwa durch die Standardisierung von technischen Bausteinen – ist
somit eine zentrale Voraussetzung, um Skalierung zu ermöglichen.
Insgesamt bestätigen die Befunde die Eingangshypothese der Begleitforschung, wonach
Datentreuhänder ein mögliches Instrument zur positiven Beeinflussung des Wert-Risiko-
Dilemmas beim Datenteilen darstellen. Dabei wird sich aller Voraussicht nach nicht das eine,
domänen- und sektorübergreifend zu bevorzugende Datentreuhandmodell durchsetzen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich ein modularer Werkzeugkasten aus rechtlichen,
technischen und organisatorischen Bausteinen etablieren wird. Hierzu leistet die
Begleitforschung mit ihrer Systematisierung von Fallgruppen des Datenteilens und
entsprechend zu wählenden Funktionen eines Datentreuhänders einen Beitrag.
Aus den Befunden lassen sich erste Handlungsempfehlungen für Datentreuhandbetreiber,
politische Entscheidungsträger, Vollzugsbehörden und die öffentliche Verwaltung, sowie für
Wissenschaft und Wirtschaft ableiten. Diese Empfehlungen liegt die Erkenntnis der
Begleitforschung zu Grunde, dass neben der geeigneten Wahl von Lösungen durch die
Betreiber die rechtlichen, technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen maßgeblich
Datentreuhänder als Schlüssel zum Datenteilen: Ansätze, Herausforderungen und Empfehlungen für die Umsetzung vii
die Erfolgsaussichten von Datentreuhändern beeinflussen. Das gemeinsame Ziel aller Akteure
sollte dabei die Überwindung des eingangs aufgeworfenen Wert-Risiko-Dilemmas sein.
Datentreuhandbetreiber sollten vor allem klar definieren, welchen Mehrwert und welche
Funktionen sie für Datengebende und -nutzende bieten. Je nachdem, wie die Antwort auf
diese Frage ausfällt, lassen sich unterschiedliche technische und rechtliche Bausteine und ein
geeignetes Geschäftsmodell inklusive Trägerschaft und Finanzierungsansatz wählen. Sinnvoll
wäre es außerdem, auf einheitliche technische Komponenten zu setzen, um eine spätere
Skalierung des Datentreuhänders zu ermöglichen. Um Vertrauen im Ökosystem aufzubauen,
sollten Datentreuhandbetreiber außerdem eine geeignete Rechtsform wählen (die sich je
nach Anwendungsfeld unterscheiden mag) und strategische Partnerschaften mit relevanten
Akteuren aufbauen. Um das Datenökosystem in Gang zu bringen, sind neben den
Datentreuhändern selbst aber auch Datengebende und -nutzende aufgefordert,
entsprechende Dienste zu nutzen und sich an entsprechenden Referenzprojekten zu
beteiligen.
Der Gesetzgeber hat Hebel, um die Rechtssicherheit fürs Datenteilen wie auch für den Betrieb
von Datentreuhändern zu erhöhen. Insbesondere auf europäischer Ebene sollte erörtert
werden, den DGA dahingehend umzugestalten, dass Datentreuhänder alle Funktionen
übernehmen können, die nötig sind, um zur Auflösung des Wert-Risiko-Dilemmas im jeweiligen
Ökosystem beizutragen. Daneben sollte die Politik Standardisierung und Zertifizierung von
Datentreuhändern und Komponenten intensiver anstoßen bzw. unterstützen. Die öffentliche
Hand kann auch eine Vorreiterrolle einnehmen, etwa, in dem sie selbst Daten der Verwaltung
mittels Datentreuhändern teilt oder indem sie Anwendungsfälle für Datentreuhänder in einem
Repository systematisiert sammelt. Das BMFTR hat die Erprobung und Skalierung von
Datentreuhändern bereits mittels vierer Förderrichtlinien unterstützt. Weitere
Anschubfinanzierung von Datentreuhändern durch öffentliche Einrichtungen kann
gerechtfertigt sein, sollte aber daran geknüpft sein, dass hierbei auf Standardkomponenten
zurückgegriffen wird und die organisierte Zivilgesellschaft sowie Interessengruppen im
jeweiligen Datenökosystem noch stärker einbezogen werden.
Die Wissenschaft generiert einen beträchtlichen Teil der Daten, die für die Lösung
gesamtgesellschaftlicher Probleme von Relevanz sind. Sie findet sich daher oft in der Rolle der
Datengebendeno wn wieder, aber auch in der Rolle der Datennutzenden, wenn sie Forschung
auf Grundlage von Daten Dritter betreibt. Akteure der Wissenschaft sind daher aufgerufen, sich
unter anderem an der Standardisierung von Datenformaten zu beteiligen und interdisziplinär
den Beitrag von Datentreuhändern zur Überwindung des Wert-Risiko-Dilemmas weiter zu
beforschen. Auch sollte die Wissenschaft durch die Nutzung von Datentreuhändern zu deren
Etablierung beitragen.
Neben der Wissenschaft spielt die Wirtschaft eine zentrale Rolle beim Aufbau einer florierenden
Datenökonomie. Unternehmen sind wichtige Akteure als Kunden von Datentreuhändern.
Unternehmen und Verbände sollten sich aus Sicht der Begleitforschung daher stärker an der
Entwicklung von entsprechenden Standards beteiligen, als Referenzkunden für
Datentreuhänder engagieren und bereit sein, interne Daten über sichere
Datenverarbeitungsumgebungen mit Dritten zu teilen.
Die Befunde der Begleitforschung zeigen auf, dass einem breiten Einsatz von
Datentreuhändern in der Praxis derzeit noch rechtliche, technische und organisatorische
Herausforderungen entgegenstehen. Die Begleitforschung zeigt hier Lösungsansätze auf, die
empirisch über die Pilotprojekte identifiziert und konzeptionell-analytisch weiterentwickelt
wurden. Gleichzeitig besteht aber aus Sicht der Begleitforschung auch weiterer
Forschungsbedarf, insbesondere hinsichtlich vertrauensbildender Maßnahmen für
Datentreuhänder und das Datenteilen, technischer Aspekte zur Erhöhung von Datenintegrität
und -nutzbarkeit sowie der Interoperabilität, der Wechselwirkungen zwischen Rechtsformen
und Geschäftsmodellen sowie der Wahl eines geeigneten Betreibers und der Bepreisung von
geteilten Daten. Die identifizierten Herausforderungen beim Aufbau funktionierender
Datentreuhänder als Schlüssel zum Datenteilen: Ansätze, Herausforderungen und Empfehlungen für die Umsetzung viii
Datentreuhänder sind aus Sicht der Begleitforschung zu meistern, und die Lösungsansätze
können erfolgreich zum Einsatz gebracht werden, wenn Betreiber, Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft hier eng zusammenarbeiten. Unter dieser Voraussetzung können Datentreuhänder
einen wertvollen Beitrag zum Aufbau von Datenökosystemen leisten, mit entsprechenden
positiven Wirkungen auf Innovation und Wertschöpfung in Deutschland und in Europa.