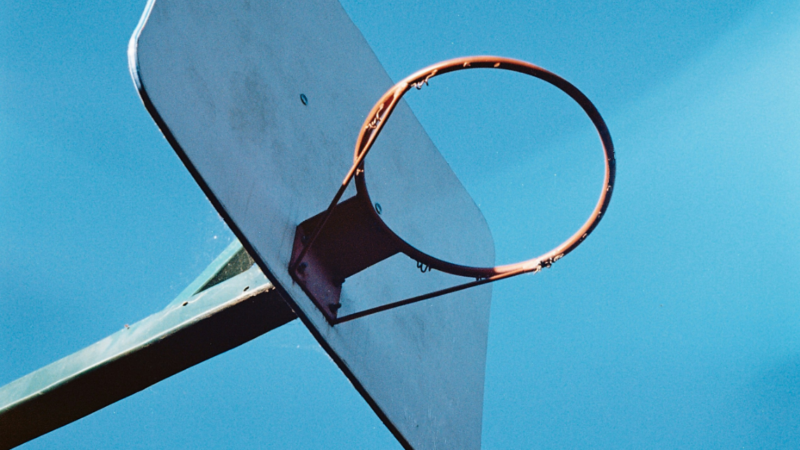Unsere vernetzte Welt verstehen

Nein zu KI: Wer widersetzt sich und warum?
Ein vergifteter Datensatz. Ein Autor*innenstreik, der Hollywood 148 Tage lang lahmlegte. Straßenproteste gegen Rechenzentren. Hinter all diesen Aktionen steht eine wachsende weltweite Resistenz gegenüber Künstlicher Intelligenz. Aufbauend auf dem aktuellen Bericht „From Rejection to Regulation: Mapping the Landscape of AI Resistance“ von Can Şimşek und Ayse Gizem Yasar untersucht dieser Beitrag, wie Künstler*innen, Beschäftigte, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen die Gestaltung, den Einsatz und die Regulierung von KI-Systemen herausfordern. Er beleuchtet die Beweggründe für die Resistenz gegen KI und entwirft eine Forschungsagenda, die diese Handlungen nicht als Hindernis, sondern als wichtigen Beitrag zu einer demokratischen KI-Governance versteht.
Künstliche Intelligenz verändert unsere Gesellschaft grundlegend. Sie wirkt sich nicht nur auf technische Systeme, sondern auch auf die Strukturen und Regeln aus, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert. Mitten in diesem Umbruch stellen sich drängende Fragen: Wer bestimmt die Richtung dieses Wandels und entscheidet über unsere Zukunft? Wessen Stimmen bleiben dabei ungehört? Sind wir bloß passive Beobachter*innen einer immer weiter voranschreitenden Einführung mächtiger Algorithmen, oder haben wir die Möglichkeit – und vielleicht sogar die Verantwortung –, diese Entwicklung infrage zu stellen und neu zu gestalten?
Formen der Resistenz gegen KI zeigen sich schon heute in vielen Bereichen und Regionen der Welt. So unterschiedlich sie in ihrer Form und Motivation auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Sie richten sich kritisch gegen das Tempo, die Zielsetzung und die Machtstrukturen, die der Entwicklung von KI häufig zugrunde liegen. Dabei handelt es sich nicht um vereinzelte Vorfälle, sondern um Teile einer breiteren Landschaft der KI-Resistenz, die es genauer zu betrachten gilt.
Widerstand gegen Technologien hat Tradition
Um die Resistenz gegen KI einzuordnen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Der Widerstand gegen neue Technologien ist kein neues Phänomen. Technologische Umbrüche haben stets gesellschaftliche Sorgen und Proteste ausgelöst. Die Bandbreite reicht von den Ludditen des 19. Jahrhunderts, die sich gegen moderne Webmaschinen wandten, da diese Arbeitsplätze zerstörten, bis hin zu den heutigen Debatten über digitale Überwachung und algorithmische Diskriminierung.
Während KI zu einer der prägendsten Technologien unserer Zeit wird, schwanken die öffentlichen Reaktionen zwischen Optimismus und Skepsis. Einerseits investieren Regierungen und Unternehmen so viel wie nie zuvor in die KI-Entwicklung. Andererseits wächst die Resistenz. Menschen und Organisationen erheben grundsätzliche Einwände gegen die Art und Weise, wie KI-Technologien entworfen, produziert, eingesetzt und reguliert werden. Doch was genau bedeutet „Resistenz gegenüber KI“?
Was ist KI-Resistenz?
„Resistenz“ im Kontext von KI umfasst ein breites Spektrum an Handlungen und Diskursen. Diese können offen oder subtil, organisiert oder lose, individuell oder kollektiv, ablehnend oder reformorientiert sein. Aus der Perspektive der kritischen Theorie sowie der Science and Technology Studies lässt sich Resistenz gegenüber KI als Form von Handlungsfähigkeit innerhalb bestehender Machtstrukturen verstehen. Dabei steht nicht die Technologie an sich im Mittelpunkt. Die Resistenz richtet sich vielmehr gegen die sozialen Strukturen und Ungleichheiten, die den Einsatz und die Entwicklung von KI bestimmen – und zugleich von ihr verstärkt werden.
Solch eine Resistenz kann sich auf vielfältige Weise zeigen, beispielsweise in Form von öffentlichen Protesten, juristischen Klagen, digitaler Subversion, wissenschaftlicher Kritik oder basisnaher Interessenvertretung. Vergleichbar mit zivilem Ungehorsam spiegeln diese Praktiken eine prinzipielle Verpflichtung zu ethischen, rechtlichen oder demokratischen Normen wider, die durch bestimmte KI-Systeme gefährdet werden. Der Begriff „KI-Resistenz” ist daher breit gefasst und offen für unterschiedliche Interpretationen, da sowohl „Resistenz” als auch „Künstliche Intelligenz” weitläufige und abstrakte Konzepte sind. Doch wie sieht sie konkret in der Praxis aus?
KI-Resistenz in der Praxis
Historische Widerstandsformen finden in der digitalen Gegenwart neue Entsprechungen. So bezeichnete „Sabotage” im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts gezielte Eingriffe in industrielle Maschinen. Angeblich warfen Arbeiter*innen ihre Holzschuhe (sabots) ins Getriebe, um die Produktion zu stoppen. Heute gibt es eine digitale Parallele: das sogenannte Data Poisoning.
Dabei verändern Künstler*innen oder andere Kreative ihre Werke gezielt, oft kaum wahrnehmbar, um KI-Modelle in die Irre zu führen. Sie können beispielsweise Bilder oder Texte so modifizieren, dass ein KI-System beim Training falsche oder verfälschte Informationen lernt. Damit wehren sich Betroffene gegen die unautorisierte Nutzung ihrer Arbeit für das KI-Training. So wird eine technische Schwachstelle bewusst als Resistenzform eingesetzt, als eine digitale Form der Sabotage.
Neben solchen technischen Mitteln greifen Beschäftigte in kreativen Branchen auch auf klassische Widerstandsformen wie Streiks zurück. Ein prominentes Beispiel ist der Hollywood-Autor*innenstreik von 2023, bei dem die Writers Guild of America vertragliche Absicherungen gegen den Einsatz von KI beim Schreiben oder Überarbeiten von Drehbüchern forderte. Der Streik dauerte 148 Tage, legte weite Teile der Film- und Fernsehproduktion in den USA lahm und markierte einen Wendepunkt in kollektiver Resistenz gegen die unregulierte Einführung von KI in Kreativbranchen.
Vom Protest zur Regulierung
In unserem Bericht haben wir zahlreiche Beispiele für KI-Resistenz dokumentiert, darunter Proteste gegen die Umweltfolgen von Rechenzentren, Resistenz von Beschäftigten großer Tech-Unternehmen gegen militärische KI-Anwendungen sowie den öffentliche Aufschrei nach dem Debakel rund um die automatisierte Bewertung von “A-Level”-Tests in Großbritannien.
Wir haben sechs zentrale Bereiche identifiziert, in denen Resistenz am häufigsten zu beobachten ist:
- (1) Kreativbranchen,
- (2) Migration und Grenzkontrolle,
- (3) medizinische KI,
- (4) Hochschulbildung,
- (5) Verteidigungs- und Sicherheitssektor sowie
- (6) Umweltaktivismus.
Die Rolle der Zivilgesellschaft, die öffentliche Gegenwehr organisiert und mobilisiert, wird besonders hervorgehoben. Zudem untersuchen wir, wie Staaten bestimmte Formen der Resistenz in Gesetze überführt haben. Ein Beispiel dafür ist der EU AI Act, der unter anderem KI-Systeme verbietet, die gezielt Menschen manipulieren sollen.
Warum widersetzen Menschen sich KI?
Der Bericht nennt außerdem fünf Hauptgründe, warum Menschen sich gegen KI wehren. Diese werden jeweils mit Beispielen aus der Praxis illustriert:
- (1) Erstens gibt es sozioökonomische Bedenken. Diese werden beispielsweise in der Kreativbranche sichtbar, wo Streiks das Potenzial von KI, menschliche Arbeitsplätze zu ersetzen, kritisch in den Blick nahmen.
- (2) Zweitens entstehen ethische Probleme, wenn KI-Systeme undurchsichtig oder voreingenommen sind. Ein Beispiel hierfür sind Tools zur Bewertung von Migrationsrisiken, die Entscheidungen über die Zukunft von Menschen unfair beeinflussen können.
- (3) Drittens stellen Sicherheitsrisiken ein Problem dar, insbesondere im Gesundheitswesen. Dort haben fehlerhafte KI-Diagnoseergebnisse dazu geführt, dass sich medizinische Fachkräfte zu Wort gemeldet haben.
- (4) Viertens gibt es Sorgen vor den Gefahren für Demokratie und Souveränität, darunter der Einsatz von KI zur groß angelegten Wahlmanipulation.
- (5) Schließlich gibt es noch die Auswirkungen auf die Umwelt: Klimaschutz-NGOs haben auf Forschungsergebnisse hingewiesen, die den erheblichen CO2-Fußabdruck des Trainings großer KI-Modelle belegen.
KI-Resistenz erforschen
Die Erforschung der KI-Resistenz ist entscheidend, um diese gesellschaftliche Bedenken sichtbar zu machen, die in technischen oder politischen Debatten manchmal untergehen. Diese Stimmen sollten nicht als bloßer Widerspruch abgetan werden. Sie sind wertvolle Orientierungspunkte für eine Regulierung, die demokratische Werte und das öffentliche Interesse besser widerspiegelt.
Die Analyse der Beweggründe und Praktiken der Resistenz zeigt die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements. Beschäftigte, Künstler*innen, Ärzt*innen, Lehrkräfte, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen fordern mehr Mitsprache darüber, wie KI entworfen, eingesetzt und reguliert wird. Werden diese Interventionen als konstruktive Beiträge anerkannt, entsteht Raum für inklusivere und gesellschaftlich fundierte Diskussionen über technologische Zukünfte. Die Frage ist also nicht, ob Resistenz KI prägen wird, sondern wie.
Unsere Forschung versteht sich deshalb als Auftakt zu einer breiteren Debatte. Sie lädt Wissenschaftler*innen, Entwickler*innen, Politiker*innen und Zivilgesellschaft dazu ein, gemeinsam eine interdisziplinäre Wissensbasis zu KI-Resistenz aufzubauen. Zu diesem Zweck haben wir am HIIG einen ersten Workshop organisiert, in dem wir unseren Bericht vorgestellt und unsere Erkenntnisse diskutiert haben. Nun wollen wir diese Arbeit mit Kolleg*innen aus unterschiedlichen Disziplinen fortsetzen. Durch das Teilen von Fallstudien, die gemeinsame Entwicklung von Konzepten und den Austausch bewährter Praktiken möchten wir dazu beitragen, dass KI-Systeme so entwickelt werden, dass sie die menschliche Würde schützen, soziale Gerechtigkeit fördern und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen.
Referenzen
Şimşek and Yasar (2025). From Rejection to Regulation: Mapping the Landscape of AI Resistance. Available here: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5287068
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autor*innen und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Themen im Fokus
Der Human in the Loop bei der automatisierten Kreditvergabe – Menschliche Expertise für größere Fairness
Wie fair sind automatisierte Kreditentscheidungen? Wann ist menschliche Expertise unverzichtbar?
Gründen mit Wirkung: Für digitale Unternehmer*innen, die Gesellschaft positiv gestalten wollen
Impact Entrepreneurship braucht mehr als Technologie. Wie entwickeln wir digitale Lösungen mit Wirkung?
Bias erkennen, Verantwortung übernehmen: Kritische Perspektiven auf KI und Datenqualität in der Hochschulbildung
KI verändert Hochschule. Der Artikel erklärt, wie Bias entsteht und warum es eine kritische Haltung braucht.